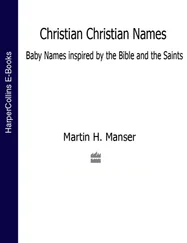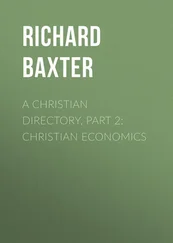Christian Kortmann - Einhandsegeln
Здесь есть возможность читать онлайн «Christian Kortmann - Einhandsegeln» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Einhandsegeln
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Einhandsegeln: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Einhandsegeln»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
In einem vielstimmigen Gespräch – unter anderem mit polynesischen Bootsfahrern – erlebt der Einhandsegler die Abenteuer seines Lebens. In seinem Logbuch hält er Koordinaten, Tagesabläufe und Erkenntnisse fest. Gegen Ende seiner Reise steht er vor einer Entscheidung: Soll er sich dem Zugehörigkeitswunsch zur Gesellschaft unterordnen oder doch im Trost der Einsamkeit seinen eigenen Weg gehen?
Einhandsegeln — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Einhandsegeln», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ich habe mir eine Großartigkeit geschenkt.
Ein Säuger nähert sich bugseits. Er kreist seihend um mein Boot, viel Grünzeug hier. Dann legt sich das Tier in Lee auf den Rücken. Ab und zu hebt es den Kopf aus dem Wasser und blickt zu mir hinauf. Ich beobachte es mit dem Glas und schaue in seine nachtblauen Augen: Hallo, Wesen!
Es weiß, dass es sich Zeit lassen kann. Im Vergleich zu ihm bin ich die lahmste Ente und noch länger in der Gegend. Ich wünsche ihm einen guten Fang. Doch das Tier will nichts mit mir zu tun haben, es hat eine schöne Strömung gefunden und zieht sich zurück. Ein Wellenkamm und ich sehe noch seinen Kopf, zwei Wellenkämme und es ist wieder verschwunden.
Der Südwest ist stärker geworden. Der Windmesser zeigt 9 Beaufort. Solide 6-Meter-Dünung. Böenwetter. Beweg-dich-Wetter.
Manöver: Großsegel reffen, den Klüver bergen und das Try und die Sturmfock setzen.
So viel zu tun an Bord, ich komme kaum zum Nichtstun und zum Segeln-Genießen …
Eine Morsenachricht trifft ein. Ah ja, ich sehe, von wem sie stammt. Die Lektüre hebe ich mir für später auf und verlängere die Vorfreude auf einen gesellschaftlichen Höhepunkt in meinem Leben.
Ich liebe die Rauheit dieser Tage.
Die Gischt, den Gegenwind, die Gnadenlosigkeit, mit der mir die Natur begegnet.
Rau, wie die schönsten Stimmen.
Rau, wie die ernste Seite der Feile.
Rau, wie das Rough beim Golf, wenn das Spiel stockt und du nicht einfach weitermachen kannst wie geplant. Erst wenn du im Spiel der Naturgewalten auf dich allein gestellt bist, merkst du, was du wirklich kannst.
Einhandsegeln stellt die höchsten Ansprüche. Ans Material und an den Segler, der segeln können muss wie im Schlaf und als Kind auf dem Wasser aufgewachsen ist. Aber es gibt auch die, die zur Weltumrundung aufbrechen, ohne jemals zuvor gesegelt zu sein. Die Dinge, die du nicht lernen kannst, sondern die zu lernen bedeutet, sie zu tun. Denn noch wichtiger als deine fachliche und körperliche Eignung ist deine psychische Disposition: Wir Einhandsegler verbringen Wochen, Monate, manchmal gar Jahre allein auf See. Wir berühren, umarmen, küssen, schmecken, riechen keinen anderen Menschen. Wir sehen andere unserer Art nur, wenn wir zufällig einem Handelsschiff begegnen und Besatzungsmitglieder uns von der Reling aus zuwinken. Land kennen wir nur noch aus der Ferne, das Rollen und Stampfen unseres Bootes ist uns zum festen Boden geworden. Als Einhand-Weltumsegler solltest du dich selbst kennen, also denjenigen, mit dem du so lange auf engstem Raum unterwegs bist. Vor dem, was du noch nicht kennst, darfst du keine Angst haben. Denn die einzige Flucht vor dir selbst auf See ist eine ohne Wiederkehr.
Einhandsegler bilden einen Orden der Individualisten, die sich zusammentun würden, wenn sie das Zusammentun nicht so sehr verachteten. Die nicht groß miteinander schnacken, sondern sich auf See aus sicherer Entfernung ihre Kurse zumorsen und sich eine weiterhin gute Alleinreise wünschen. Männer und Frauen, die sich unter den Menschen beengt und einsam fühlen und die diesem Gefühl nur in der völligen Isolation der Weltmeere entkommen können. In der Isolation, die dich so intensiv mit dir selbst verbindet.
Vor allem in Zeiten, in denen sie noch intakt war.
Ich rede von denen, die sich nicht rund um die Uhr mit Social Media, Chats und Satellitentelefonaten bedudelt haben. Die keine Schleppnetznabelschnur in den Heimathafen hatten. Die sich nicht jederzeit in den Strom des Geschehenden einklinken konnten. Fern aller Ströme, körperlich und als Redner, Zuhörer, Denker abgeschnitten vom Rest der Welt, waren sie ihr eigenes Weltgeschehen. Hörten ein Jahr lang nur See, Wind, das Blasen der Meeressäuger und Vogelschreie.
An menschlichen Lauten kamen ihnen nur ihre Körpergeräusche und Selbstgespräche zu Ohren.
Sie hörten ein Jahr lang die Stimmen ihrer Liebsten nicht, nicht die von Frau und Kind, und wenn sie es doch taten und diese Stimmen auf mitgebrachten Tonbandkassetten in einer ruhigen dunklen Minute in der Kajüte abspielten, dann schossen ihnen die Tränen wie Sturzseen durchs Gesicht. Nur ab und an, wenn sie an den Küsten von Kontinenten und Inseln oder in der Nähe von Frachtschiffen in Funkreichweite kamen, wechselten sie ein paar Worte mit den diensthabenden Funkern. Und gaben ihnen Nachrichten nach Hause durch – oder katapultierten sie mit Steinschleudern auf das andere Schiff: »Nach schweren Tagen auf See bei schönem Südost glücklich hinter Hoorn. Vermisse Euch! In Liebe, C.«
Diese Nachrichten wurden dann an die Liebsten telegrafiert. Antwort: ungewiss.
Wie die höchsten Berge ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen werden müssen, sollten Weltumsegelungen nur ohne Internet zählen, ohne künstlichen sozialen Sauerstoff.
Ich rede von den ruhigen Rastlosgeistern, deren neugierige Lust auf sich selbst immer schon größer gewesen ist als ihre Einsamkeitsstrapazenangst. Von denen, die die Gefahr, an Land zu bleiben, höher einschätzten als Schiffbruch vor Kap Hoorn. Zu unflüssig ist so ein Landrattenleben, zu gewiss führt das Rennen auf direktem Wege von der Wiege zur Biege.
Die Angst, als der falsche Mensch zu leben.
Wir stehen an der Küste und blicken auf die Weite des Ozeans. Wo andere Menschen den Horizont sehen, erkennen wir das Versprechen auf ein anderes Leben im Ungewissen. Deshalb gehen wir in dem Moment, in dem wir genug Mut gefasst haben und fürchten müssen, ihn bald wieder zu verlieren, an Bord unseres Segelbootes. Wir lösen die Leinen, um den Horizont zu befragen und sein Versprechen eingelöst zu sehen. Wir setzen einen Kurs in die ausgedehnteste irdische Einsamkeit hinein, in der unsere eigene Einsamkeit winzig klein erscheint. Von Bord gehen wir frühestens dann, wenn wir den Ort unserer Abfahrt wieder erreicht haben.
Und dann …
Und dann …
Dann ist mir die Welt zu klein geworden.
Haushohe Wellen am Beginn der Drake Passage, die Bewegung meines Lebens ist das Heben und Senken von Kate Moss’ Bug.
Eine Gang von Fregattvögeln checkt uns ab. Ich hebe meine Hände hoch und ergebe mich. Mehr als ein paar Croissantkrümel ist bei mir nicht zu holen …
Steuerbords liegt die Isla de Los Estados, diese unbewohnte schroffe waldreiche Trauminsel. Von tiefen Buchten gekerbt, sehen ihre Konturen auf dem Globus aus wie die Unterschrift von Gottes kleinem, linkshändigem Bruder. Dem Kreativen, der mit der strengen Weltanordnung nicht einverstanden war. Durchs Glas sehe ich einige ihrer Gipfel. Das saftige Grün der Baumkronen scheint gegen meine Scheibe zu schlagen, zum Greifen nah. Dort tagelang umherstreifen, mit Zelt und Schlafsack …
Als ich allein an einem Strand lief, fast wie Robinson: Ein müheloses, leichtes Gehen war das. Die Steine unter meinen Füßen wurden unregelmäßiger in Form, Größe und Trittfestigkeit. Viel Arbeit für die Fußsprunggelenke, das Gehen von Schritt zu Schritt schwieriger. Vor mir umgestürzte Bäume, die von der Steilküste bis in die Brandung ragten. Ich lief auf Barrieren zu, die unüberwindlich erschienen. Zumindest aus der Entfernung. Wenn ich mich der Barriere näherte und ihre genaue Struktur sichtbar wurde, dann ging es doch. Dann erkannte ich zwar nicht den kompletten Weg hindurch, aber Pforten im Labyrinth. Unter manchen Baumstämmen musste ich mich hindurchbücken, über andere musste ich hinwegklettern. Mal musste ich ein Stück am sandigen Ufer hochsteigen und wieder hinunter, so weit den Strand hinaus, dass ich mir nasse Füße holte. Wenn die Barriere schließlich hinter mir lag, sah sie wieder genauso unüberwindbar aus wie zuvor und ich wusste nicht mehr, wie ich sie überwunden hatte.
Ist es nicht mit allen Hindernissen so?
Francis Chichester hatte Krebs und nach Meinung seiner Ärzte nur noch wenige Monate zu leben.
Was machte Francis? Sag es mir.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Einhandsegeln»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Einhandsegeln» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Einhandsegeln» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.