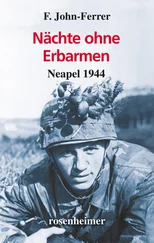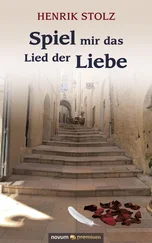Was will dieses Buch?
Ziel dieses Buches ist es nicht, dass du vorurteilsfrei wirst – das wird vermutlich auch dem weltbesten Ratgeber nicht gelingen. Das Buch soll dich stattdessen stolz machen – stolz darauf, dass du genau wie jeder andere Mensch anders und einzigartig bist. Du sollst nicht stolz darauf sein, keine Vorurteile zu haben, aber stolz darauf, dass du anderen zunehmend offener begegnen kannst und dir deine Vorurteile zumindest immer häufiger bewusst werden. Wie das gelingt, möchte ich dir in diesem Buch zeigen. Es soll helfen, die eigenen Vorurteile zu erkennen. Das ist der erste Schritt, um sie zu verändern und auch mit anderen darüber zu sprechen, um mehr Akzeptanz untereinander zu schaffen.
In den folgenden Kapiteln erzähle ich dir Geschichten und Fakten über Menschen, die häufig Vorurteilen ausgesetzt sind. Ich habe sie oder ihre Geschichten entweder durch meine Arbeit als Journalistin kennengelernt oder im Privatleben. Teilweise haben die Begegnungen auch meine eigenen Vorurteile abgebaut und mich umdenken lassen. Ich möchte dir zeigen, dass Wissen und Aufklärung die beste Waffe gegen gefährliche oder verletzende Vorurteile sind. Wenn dir diese Geschichten nur ab und zu einen Denkanstoß geben, dann wird es dir auch bei anderen Menschen leichter fallen, erst einmal hinter die Fassade zu schauen, bevor du ihnen mit Vorurteilen begegnest. Das lohnt sich zum einen für deine Mitmenschen. Denn das Schöne ist, dass auch einzelne kleine Situationen das Leben eines anderen verändern können. Wenn sich ein Schüler zum Beispiel einen beleidigenden Kommentar bei einem übergewichtigen Mitschüler spart oder ein Obdachloser mit Respekt behandelt wird. Aber es lohnt sich zum anderen auch für dich selbst: Du wirst überrascht sein, um wie viele positive Begegnungen dich das reicher macht.
Wichtig ist mir dabei: Selbstverständlich sind diese Geschichten nur Beispiele aus meinen Erfahrungen und meiner Recherche. Ich möchte damit zeigen, dass nicht alle Menschen in die vorgefertigten Schubladen passen und dass viele Vorurteile ungerechtfertigt sind. Das heißt aber nicht, dass du vielleicht bei dem einen oder anderen Thema trotzdem einen Menschen kennst, der exakt dem Klischee entspricht.
Außerdem zähle ich der Einfachheit halber in diesem Buch nur eine Geschlechtsform auf, das heißt, wenn ich von Studenten spreche, dann meine ich selbstverständlich Studentinnen und Studenten beziehungsweise alle Studierenden.
Auch wenn es mir leidtut, dass das nötig ist: Viele Namen von Betroffenen habe ich in diesem Buch verändert, um sie zu schützen. Denn auch wenn ich mir Toleranz für sie wünsche, ist sie leider in den Köpfen vieler Menschen noch nicht vorhanden.
Zum Ende dieses Buchanfangs noch ein Zitat von Albert Einstein: »Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten, als ein Vorurteil.« Aber es ist nicht unmöglich. Auch wenn wir dazu keine Atomphysiker werden müssen: Lasst uns anfangen, unsere Energie sinnvoll zu nutzen, sonst fliegt sie uns irgendwann um die Ohren.
1. Kapitel Die Kanaken – Oder: Warum nicht nur der Döner zu Deutschland gehört, sondern auch der Dönermann
Weißt du, was ein Kanake ist? Na klar, ein Schimpfwort für Türken. Steht sogar im Duden. Allerdings ist die Verwendung als Schimpfwort nur an zweiter Stelle genannt, denn zuerst steht die eigentliche Bedeutung, die eine ganz harmlose ist: Ein Kanake ist ein Ureinwohner der Südseeinseln. Das Wort entstammt vermutlich dem Hawaiianischen. Es wurde zunächst in verschiedenen europäischen Regionen positiv zweckentfremdet als Begriff für alle ausländisch aussehende Menschen und in Deutschland erst mit dem Anwerbeabkommen in den Siebzigerjahren im negativen Sinn für Gastarbeiter benutzt. So wie ein harmloses Wort zu einem Schimpfwort werden kann, kann ein friedvoller Mensch zu einer Projektionsfläche für Vorurteile und Ängste werden.
Wir beurteilen Menschen auf den ersten Blick danach, wie sie aussehen. Wie eingangs beschrieben, ist das soweit normal. Schwierig ist dennoch für »anders« beziehungsweise »fremd« aussehende Menschen, was diese Ausgrenzung mit ihnen macht: Sie gehören von vornherein nicht dazu. Sie werden nicht als Deutsche wahrgenommen, ob sie hier geboren sind oder nicht. Nur in zwei Dingen sind sie für unsere Gesellschaft selbstverständlich: Wenn sie günstig ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen oder zum Wohlbefinden der restlichen Bevölkerung beitragen. Denn ihre Dienstleistungen werden gern in Anspruch genommen: Italiener sind gut genug, um uns eine leckere Pizza zu backen, Russen, um unseren Kindern Klavierunterricht zu geben, Chinesen, um uns Akupunkturnadeln zu setzen, Thailänder, um uns den Rücken zu kneten, Polen, um unsere Alten zu pflegen, Bulgaren, um unser Obst zu ernten, und Türken, um uns billig die Waschmaschine zu reparieren und selbstverständlich den geliebten Döner zu servieren. Wir brauchen sie, um unsere Gesellschaft am Laufen zu halten – und besonders oft brauchen wir sie, um die weniger schönen Aufgaben erledigen zu lassen oder möglichst günstig an Dinge zu kommen, für die ein »Deutscher« mehr Geld verlangen würde. Sie sind jedoch alle nicht gut genug, um losgelöst von ihrer Herkunft als gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Ob es ein türkischer, russischer oder italienischer Nachname ist: Er erschwert seinem Träger die Ausbildungs-, Arbeits- oder Wohnungssuche bereits, bevor das Gegenüber ihn überhaupt kennengelernt hat. Der Stempel »nicht deutsch« ist innerhalb von Sekunden aufgedrückt, aber nur extrem mühsam wieder zu entfernen.
Jede Gruppe von Menschen, die nach Deutschland eingewandert ist, ebenso wie jeder Einzelne, hat eine ganz persönliche Einwanderungsgeschichte. Beispielhaft für die vielen verschiedenen Nationen möchte ich in diesem Kapitel besonders auf Menschen mit türkischstämmigem Hintergrund eingehen, da ich mich während eines Auslandssemesters in der Türkei sowie in den Jahren davor und danach besonders damit beschäftigt habe. Darüber hinaus sind viele von ihnen Muslime, und das führt in Deutschland ganz besonders zu Ausgrenzung und Vorurteilen.
In der Bundesrepublik leben drei Millionen Türken (beziehungsweise Türkischstämmige), doch wenn über sie gesprochen wird, dann fallen vielen zuerst die Unterdrückung der Frau (»Die müssen alle Kopftuch tragen«) und die radikalen Islamisten ein (»Die sprengen uns noch alle in die Luft«). Die deutsche Rechnung lautet schnell: Türken = Muslime = Islamisten = Gefahr für Deutschland. Darüber hinaus werden sie für ungebildet und rückständig gehalten. Aber woher kommen diese Vorurteile?
Warum haben türkischstämmige Menschen hier einen so schlechten Stand?
Wir vergessen gerne, dass es Menschen aus der Arbeiterschicht waren, die beim Anwerbeabkommen in den Sechziger- und Siebzigerjahren nach Deutschland geholt wurden. Damals sind Türken und Italiener nicht von allein gekommen, die Deutschen wollten sie haben. Die hiesige Wirtschaft boomte, und es gab nicht genug Deutsche, die in den Fabriken arbeiten konnten oder wollten. Also holte man Türken und Italiener hierher. Angefordert wurden aber nicht die Studierten, sondern jene, die für wenig Geld viel wegschaffen konnten. Wichtigstes Kriterium war dabei, dass die sogenannten »Gastarbeiter« (überwiegend männlich) gesund und kräftig waren. Dass sie bereits eine Ausbildung hatten, war ausdrücklich nicht erwünscht, sodass einige Türken auf der Istanbuler Verbindungsstelle lieber verschwiegen, wenn sie doch eine Ausbildung hatten. Die meisten waren tatsächlich aber nicht besonders gebildet. Die Deutschen wollten damals billige Arbeitskräfte, die keine Fragen stellen, und heute werden als Migranten gut ausgebildete Menschen erwartet, die sich in die Gesellschaft einfügen, als wären sie schon immer Deutsche gewesen. Das lässt sich nur schwer damit rechtfertigen, dass die Gastarbeiter nach ein paar Jahren, wenn sie Deutschland genug zu Reichtum verholfen hatten, wieder nach Hause zurückkehren sollten. Die Hälfte von ihnen ging tatsächlich zurück, die andere Hälfte blieb – aber nicht nur, weil sie das unbedingt wollten, sondern auch, weil ihre Arbeitskraft weiter benötigt wurde. So etwas wie Integrationskonzepte gab es trotzdem weiterhin nicht. Integration musste also quasi von selbst laufen; die Ungebildeten mussten sich vielerorts allein um Bildung und Anschluss bemühen.
Читать дальше