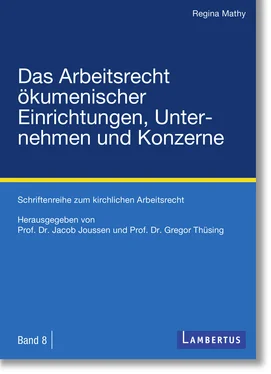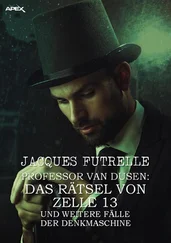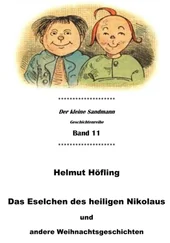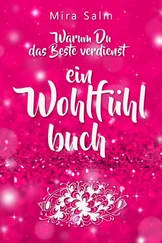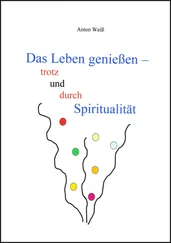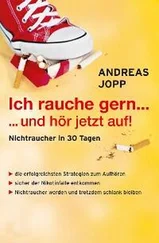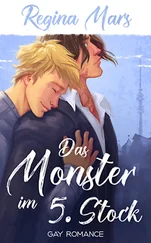2. Ordnen und Verwalten eigener Angelegenheiten (sachlicher Schutzbereich)
Bei den verfassten Kirchen in Deutschland handelt es sich unbestritten um Religionsgemeinschaften i.S.d. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV. Wenn sie sich nicht als „die eine christliche Kirche“ zusammen auf das Selbstbestimmungsrecht berufen können, so steht dieses Recht jedenfalls jeder Kirche für sich zu. Insofern muss eine ökumenische Betätigung – konkret die Gründung und der Betrieb einer ökumenischen Einrichtung – mit Blick auf jede Kirche unter den sachlichen Schutzbereich fallen. Geschützt wird sämtliches Wirken der Religionsgemeinschaften und ihre Einflussnahme auf den gesellschaftlichen Bereich. 456
a) Selbstständiges Ordnen und Verwalten
„Selbstständiges Ordnen“ meint die gesamte Rechtssetzungstätigkeit der Religionsgemeinschaften die eigenen Angelegenheiten betreffend. 457Die Religionsgemeinschaften sollen die Möglichkeit erhalten, unabhängig eigene Rechtsbestimmungen zu erlassen (originäre Normsetzungskompetenz). 458Ihre Organisationsgewalt ist dabei unabhängig von der staatlichen. 459Anders verhält es sich hingegen, wenn die Religionsgemeinschaften den Status der K.ö.R. innehaben und außerhalb der eigenen Angelegenheiten Recht setzten dürfen. Hierbei handelt es sich um vom Staat verliehene (autonome) Normsetzungskompetenz. 460
„Selbstständiges Verwalten“ meint die Möglichkeit der Organe der Religionsgemeinschaft, sich nach eigenem Verständnis frei zu betätigen, um die jeweiligen Ziele der Religionsgemeinschaft zu verwirklichen. 461Hierzu zählen Vollzugsmaßnahmen, die eigene Rechtsprechung sowie die Möglichkeit zum Erlass eines eigenen Verfahrensrechts. 462
b) „Ihre Angelegenheiten“
Das „selbstständige Ordnen und Verwalten“ durch die Religionsgemeinschaften bezieht sich auf deren „eigene Angelegenheiten“. Was hierzu zählt, war lange Zeit unklar. 463Die zwischenzeitlich vertretene und vom BVerfG aufgenommene Abgrenzung nach der „Natur der Sache“, d.h. der Zweckbestimmung, legt eine objektive Betrachtung zugrunde. 464Dem Staat die Entscheidung zu überlassen, was die Religionsfreiheit und insbesondere das Selbstbestimmungsrecht schützen sollen, ist unvereinbar mit dem Neutralitätsgebot. 465Insofern statuierte das BVerfG konsequenterweise, dass Ausgangspunkt weiterhin der staatliche Rahmenbegriff ist, wobei das kirchliche Selbstverständnis für die Qualifizierung einer Angelegenheit als eigene im Sinne des Art. 137 Abs. 3 WRV maßgebend ist. 466Es ergibt sich aus Sicht des BVerfG lediglich eine eingeschränkte Kontrollintensität staatlicher Gerichte auf Basis einer vom BVerfG entwickelten zweistufigen Prüfung 467: Auf der ersten Stufe findet eine Plausibilitätskontrolle statt. 468Diese erfolgt basierend auf dem glaubensdefinierten Selbstverständnis und der Eigenart des kirchlichen Dienstes. 469Auf der zweiten Stufe erfolgt eine Gesamtabwägung (Wechselwirkungslehre). 470Dabei stehen sich die kirchlichen Belange und die hiermit kollidierenden Interessen gegenüber, wobei dem Selbstverständnis der Kirchen ein besonderes Gewicht zukommt. 471
Aufgrund der durch die langjährige Auseinandersetzung gewonnenen Erkenntnisse besteht heute weitgehende Einigkeit, was unter „eigene Angelegenheit“ zu verstehen ist. 472Hierzu zählt nach herrschender Meinung alles, was für die Umsetzung des Auftrags der Religionsgemeinschaften nach ihrem Selbstverständnis erforderlich ist. 473Dass sich diese Aufgabenwahrnehmung nicht nur rein innerkirchlich widerspiegelt, sondern auch auf den weltlichen Bereich auswirkt, spielt dabei keine Rolle. 474Originär eigene Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften 475betreffen beispielsweise Lehre und Kultus 476, Rechtsetzung, Bildung einer eigenen Kirchengerichtsbarkeit 477, die interne Organisationsstruktur 478, diakonische bzw. karitative Tätigkeiten 479sowie – hier von besonderer Relevanz – das kirchliche Dienst- und Arbeitsrecht 480. Einen Sonderfall bilden diejenigen Angelegenheiten, die von Staat und Religionsgemeinschaften gemeinsam verwaltet werden. 481In der Praxis betrifft dies vor allem den karitativen Bereich. 482
c) Angelegenheiten ökumenischer Einrichtungen
Damit ökumenische Einrichtungen abgeleitet von einer oder mehreren Religionsgemeinschaften am verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrecht teilhaben können, müssen auch gemeinsame Betätigungen mehrerer Religionsgemeinschaften als eigene Angelegenheit i.S.d. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV gelten.
(i) Grammatische Auslegung
Der Wortlaut des Art. 137 Abs. 3 WRV „ihre Angelegenheiten“ kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung verstanden werden: „Ihre“ Angelegenheiten bezieht sich auf die Religionsgemeinschaft. Hieraus könnte man schließen, dass es sich lediglich um die Angelegenheiten einer Religionsgemeinschaft handeln kann. Diese Auslegung würde dazu führen, dass von mehreren Kirchen getragene ökumenische Einrichtungen nicht am Selbstbestimmungsrecht partizipieren können. Die Beteiligung mehrerer schließt demnach die Geltung des Selbstbestimmungsrechts für eine Kirche aus. Andererseits zeichnet sich eine ökumenische Einrichtung gerade dadurch aus, dass sie gemeinsam von konfessionsverschiedenen Religionsgesellschaften getragen wird. Insofern ist es jeweils für sich gesehen „ihre“ Angelegenheit. Der Zusammenschluss in einem Rechtsträger ändert hieran nichts. Die Einrichtung leitet das Selbstbestimmungsrecht nach diesem Verständnis gleichzeitig von beiden Konfessionen ab. Die besseren Argumente sprechen für die letztgenannte Interpretation. Auch wenn man „ihre“ Angelegenheiten bezogen auf jede Religionsgemeinschaft für sich versteht, handelt es sich bei ökumenischen Betätigungen um eine Angelegenheit der jeweils einzelnen Kirche, die gemeinsam mit anderen Kirchen verfolgt wird.
(ii) Systematisch-teleologische Auslegung
Bei Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV handelt es sich um einen Teil der korporativen Religionsfreiheit. 483Insofern ist die Gewährleistung im Lichte von Art. 4 Abs. 1, 2 GG auszulegen. Was Teil „ihrer Angelegenheiten“ ist, definiert die Verfassung nicht näher. Dies ist auch nur konsequent: Zum einen wäre eine exemplarische Aufzählung im Rahmen des GG wenig zweckmäßig und zum anderen – und das ist das entscheidende Argument – steht es den Verfassungsgebern nicht zu darüber zu befinden, was als „ihre Angelegenheit“ anzusehen ist. Der weltanschaulich-neutrale Staat darf weder den Glauben des Einzelnen bewerten noch darüber befinden, was eine Religionsgemeinschaft im Einzelnen tut. 484Den Religionsgemeinschaften kommt das Recht zu, dasjenige, was ihrem Selbstverständnis nach zum kirchlichen Auftrag gehört und zu dessen Verwirklichung erforderlich ist, ohne staatliche Aufsicht oder Einflussnahme umzusetzen. 485Sieht es die Kirche zur Verfolgung kirchenspezifischer Zwecke als notwendig an, mit anderen Kirchen zusammenzuarbeiten, entspricht dies ihrem jeweiligen Selbstverständnis. 486Dem Staat steht es nicht zu, das Selbstverständnis der Kirchen und deren ökumenische Zielsetzung zu beurteilen. 487Auch im Sinne einer stetigen Fortentwicklung der Religionsgemeinschaften darf der Staat diese Bestrebungen nicht einschränken oder gar unterbinden.
3. Innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes
Die selbstständige Ordnung und Verwaltung eigener Angelegenheiten durch die Religionsgemeinschaften erfolgt innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Eine Beschränkung kann nur durch formelle Bundes- oder Landesgesetze erfolgen. 488Was indes konkret unter dem Schrankenvorbehalt zu verstehen ist, ist seit jeher umstritten. 489In der Weimarer Zeit legte man zunächst ein sehr wörtliches, rein formales Verständnis bei der Einordnung zu Grunde. 490Dieses Verständnis wurde jedoch dem Schutzgehalt des Art. 137 Abs. 3 WRV als Ausprägung der Religionsfreiheit nicht gerecht. 491Rechtsprechung und Literatur vertraten in der Folge lange Zeit die sog. Heckel´sche Formel. 492Hiernach ist ein für alle geltendes Gesetz „(…) ein Gesetz, das trotz grundsätzlicher Bejahung der kirchlichen Autonomie vom Standpunkt der Gesamtnation als notwendige Schranke der kirchlichen Freiheit anerkannt werden muss (…)“ . 493Unklar war allerdings, was unter einem für die Gesamtnation „notwendigen“ Gesetz zu verstehen ist. 494Zwischenzeitlich nahm das BVerfG die Einordnung anhand einer Differenzierung zwischen innerkirchlichem und weltlichem Bereich vor (Bereichslehre). 495Sobald die innerkirchliche Sphäre betroffen ist, greift der Schrankenvorbehalt nicht; dieser Bereich ist staatlicher Einflussnahme vollständig entzogen. Für den Außenbereich greift der Schrankenvorbehalt nur soweit die Kirchen wie jeder andere auch betroffen sind. 496Dabei ist die eigens vom BVerfG entwickelte „Jedermann-Formel“ zugrunde zu legen. 497Somit ist jedes gegen die Religionsgemeinschaften gerichtete Sonderrecht unzulässig. 498Die Differenzierung zwischen religionsgemeinschaftlichem Innen- und Außenbereich ist im Gesetz jedoch nicht angelegt. Zudem ist eine trennscharfe Abgrenzung beider Bereiche nicht möglich. 499Insofern bringt auch diese Formel nicht die notwendige Klarheit.
Читать дальше