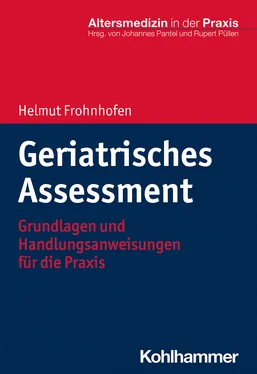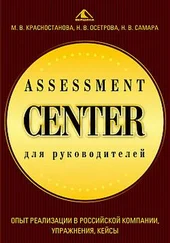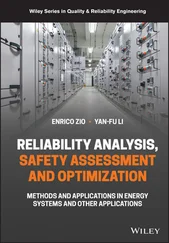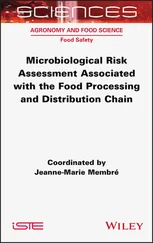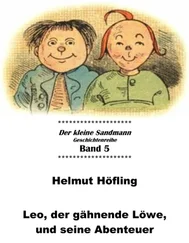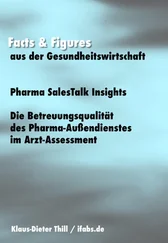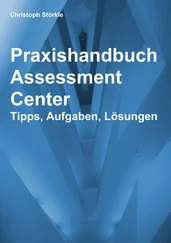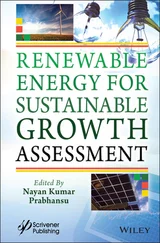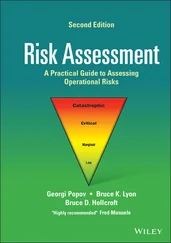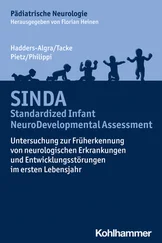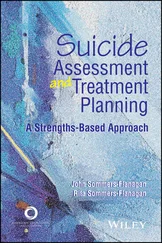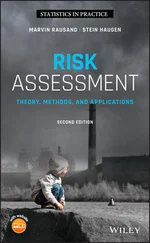Für das hausärztlich-geriatrische Basisassessment wurde das etwas umfassendere Manageable Geriatric Assessment (MAGIC)-Instrument konzipiert (Junius-Walker et al. 2016). MAGIC ist eine Testbatterie mit den Bereiche Leistungsfähigkeit, Sehen, Hören, Stürze, Harninkontinenz, Depressivität, soziales Umfeld, Impfstatus, Kognition und fakultativ Schmerz, Schwindel, Mobilität, Beweglichkeit, ungewollter Gewichtsverlust sowie Medikamentencheck. Für die jeweiligen Bereiche werden validierte Testverfahren vorgeschlagen.
3.3 Geriatrisches Assessment bei Heimbewohnern
Bestehen funktionelle, kognitive oder soziale Probleme, die einen Verbleib zu Hause nicht mehr möglich machen, finden ältere Menschen Aufnahme in einem Pflegeheim. Dies bedeutet auch, dass bei Bewohnern eines Pflegeheimes immer Einschränkungen zu erwarten sind. Dies muss bei der Auswahl von Assessmentverfahren berücksichtigt werden.
Die Intention eines geriatrischen Assessments im Pflegeheim ist es, Einschränkungen in den Domänen der Aktivitäten des täglichen Lebens (Basic Activities of Daily Scale, BADLs), Instrumental Activities of Daily Living, IADLs), der Kognition, der Emotion und der Mobilität zu quantifizieren, Ressourcen zu dokumentieren, die Indikation für eine Behandlung zu stellen (Therapieplan) und den weiteren Verlauf zu erfassen.
Grundsätzlich können zwei Gruppen von Heimbewohnern unterschieden werden. Eine Gruppe bilden die älteren Menschen, die nach einem vorherigen Krankenhausaufenthalt noch nicht wieder in ihre bisherige Häuslichkeit zurückkehren können. In einer solchen Kurzzeitpflegeeinrichtung ist das Ziel die Restitution und Rehabilitation mit anschließender Entlassung in die Häuslichkeit. Bei dieser Patientengruppe müssen besonders Einschränkungen im Bereich der Funktionalität/Mobilität und deren Veränderung erfasst werden. Der verfügbare Zeitraum beträgt etwa drei bis vier Wochen.
Die andere Gruppe umfasst Menschen, die aufgrund von Einschränkungen dauerhaft in einem Pflegeheim verbleiben. Hier verfolgt das Assessment das Ziel, diese Einschränkungen und die vorhandenen Ressourcen aufzudecken und Therapiepläne unter dem Aspekt des Erreichens der bestmöglichen Funktionalität und Lebensqualität (Morley et al. 2017).
So kann zum Beispiel die Fähigkeit zum Treppensteigen bei der ersten Gruppe ein sehr sinnvolles therapeutisches Ziel sein, nicht aber bei der zweiten Gruppe, da diese ja in einer seniorengerechten und barrierefreien Umgebung lebt.
3.4 Geriatrisches Assessment in einer geriatrischen Fachabteilung
Waren initial die Domänen eines umfassenden geriatrischen Assessments ADL, IADL, Kognition, Mobilität, Emotion und soziale Situation, so erweitert sich sein Inhalt stetig. Dies liegt auch daran, dass die Relevanz weiterer Domänen erkannt wird und Instrumente verfügbar sind, die ein valides Assessment in weiteren Domänen wie Schmerz, Schluckfähigkeit oder Schlaf ermöglichen.
3.5 Geriatrisches Assessment in nichtgeriatrischen Fachabteilungen
Mit dem zunehmenden Alter der in den verschiedenen Fachabteilungen der Krankenhäuser behandelten Patienten steigt auch der Anteil derer, die neben ihren Indikatorerkrankungen auch Einschränkungen in geriatrischen Domänen zeigen. Diese sollten erkannt werden, da sie prognostische Relevanz haben. Hier können valide Screeninginstrumente verwendet werden. Jedoch fehlen bisher – mit Ausnahme der Onkologie – validierte Empfehlungen.
3.6 Geriatrisches Assessment in der Notaufnahme
Die Notaufnahme eines Akutkrankenhauses ist die Anlaufstelle für akut erkrankte Patienten mit wahrscheinlicher stationärer Aufnahmenotwendigkeit. Die Notaufnahme spürt den demographischen Wandel. Die wachsende Anzahl betagter Patienten stellt hinsichtlich deren optimaler Versorgung eine Herausforderung dar (Lo et al. 2017). Daher reicht es in der Regel nicht, sich allein auf die medizinischen Probleme der älteren Patienten zu konzentrieren. Auch funktionelle, kognitive und soziale Aspekte müssen mit berücksichtigt werden, da diese auch prognostische Relevanz haben.
Studien zeigen aber, dass bei der Mehrzahl älterer Notaufnahmepatienten genau diese geriatrischen Domänen häufig nicht berücksichtigt werden (Ismail et al. 2017).
Ein weiteres Problem in vielen Notaufnahmen ist deren Überfüllung. In der alltäglichen Hektik laufen gerade ältere Patienten Gefahr, dass ihre Erkrankungen unterschätzt werden, geriatrische Probleme nicht wahrgenommen werden und zu lange Wartezeiten aufgrund von Triage-Algorithmen zusätzlich schädigen.
Dramatisch ist das Ergebnis einer Studie, die zeigen konnte, dass die Wartezeit in einer Notaufnahme bei älteren Patienten mit deren Mortalität assoziiert ist. Weiterhin schwankt die Wahrscheinlichkeit für eine Klinikaufnahme von Notfallpatienten unabhängig von demographischen Faktoren von Krankenhaus zu Krankenhaus (Ismail et al. 2017). Da die Aufnahmeentscheidung bei älteren Menschen zudem oft von nicht medizinischen Faktoren zusätzlich geprägt ist, unterstreicht dies die Notwendigkeit der Etablierung verlässlicher Kooperationsmodelle in einer Notaufnahme unter Einbindung geriatrischer Expertise (Lewis Hunter et al. 2016).
In einer Notaufnahme besteht immer der Konflikt zwischen der zügigen medizinischen Entscheidungsfindung und der Beachtung geriatrischer Probleme, da für die Durchführung eines geriatrischen Assessments in der Regel einfach die Zeit fehlt. Eine Lösung könnte die Einrichtung einer speziellen Untereinheit einer Notaufnahme speziell für geriatrische Patienten sein.
Einfacher ist die Applikation valider Assessmentinstrumente zum Screening auf geriatrische Probleme. Entsprechende Instrumente sind verfügbar und werden an anderer Stelle diskutiert. Diese Instrumente sind zeitökonomisch einsetzbar und decken bisher kaum beachtete geriatrische Probleme wie Stürze, beeinträchtigte Hirnleistung, ADL- und Mobilitätsprobleme auf. Ein geeignetes und validiertes Instrument ist zum Beispiel das Emergency-Geriatric-Screening (EGS)-Tool (Schoenenberger et al. 2014). Dieses Instrument, das in etwa fünf Minuten ausgefüllt werden kann, fokussiert auf die vier Bereiche ADL, Stürze, Mobilität und Kognition. Das Instrument deckt bisher nicht wahrgenommene Probleme auf und beeinflusst die weitere Versorgung.
Etwa 10 % der notfallmäßig in einer Notaufnahme vorgestellten älteren Patienten leiden an einem akuten Delir, welches aber nur in etwa einem Drittel dieser Fälle wirklich erkannt wird (Elie et al. 2000). Eine Demenz haben 15–40 % der älteren Notfallpatienten, wovon auch nur etwa die Hälfte in einer Notaufnahme korrekt diagnostiziert wird.
Ein auch für eine Notaufnahme geeignetes Screeninginstrument sollte bei hoher Sensitivität und Spezifität kurz und ohne großen Schulungsaufwand von allen Mitarbeitern einer Notaufnahme anwendbar sein. Instrumente, die speziell kognitive Probleme in einer Notaufnahme erfassen, sind das Brief Alzheimer Screen, der Short Blessed Test, das Caregiver Completed cAD8 und das Ottawa 3DY (Carpenter et al. 2011). Mit Ausnahme des cAD8 zeigten alle anderen Screeninginstrumente eine Sensitivität von mehr als 90 %, jedoch lag deren Spezifität zwischen 50 % und 65 %.
Die Studienlage zum Delir-Screening in der Notaufnahme ist noch nicht ausreichend, um ein Instrument besonders zu empfehlen (LaMantia et al. 2014). Anwendung finden hier die Confusion Assessment Method (CAM) und das Delirium Triage Screen kombiniert mit der CAM.
Stürze sind ein weiteres wichtiges Syndrom, mit dem sich ältere Menschen in einer Notaufnahme vorstellen. Stürze sind ungünstige Morbiditäts- und Mortalitätsprädiktoren. Nur etwa die Hälfte der Sturzpatienten ohne akute Fraktur wird stationär aufgenommen und wenn diese Patienten stationär aufgenommen werden, erhalten über 75 % lediglich eine medizinische Versorgung ohne Berücksichtigung ihrer geriatrischen Probleme (Close et al. 2012). Dabei sind die Folgen und die Folgekosten enorm, wenn nicht adäquat reagiert wird.
Читать дальше