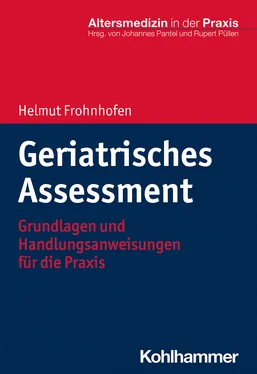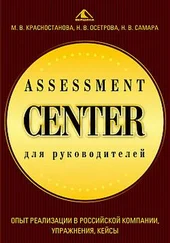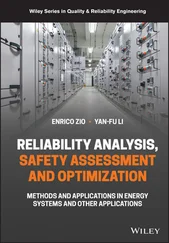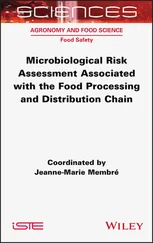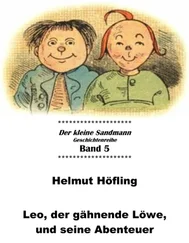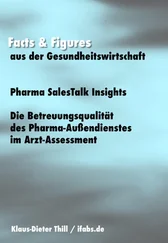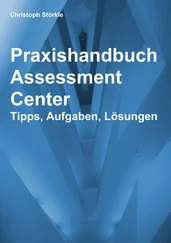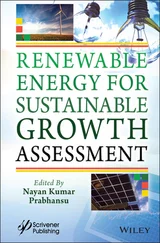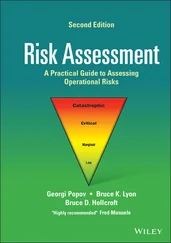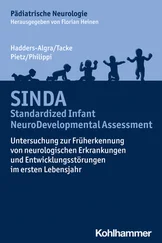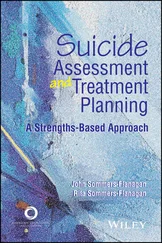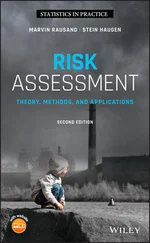Die beiden wichtigsten Maßzahlen für einen Screeningtest sind der positive und der negative prädiktive Wert. Bezüglich der erforderlichen Höhe von Sensitivität und Spezifität eines Testverfahrens gibt es keine allgemein verbindlichen Kriterien. Daher gilt es in der klinischen Praxis, einen Kompromiss zwischen diesen beiden Größen zu finden. Zudem muss eine Nutzenabwägung erfolgen, die die gesuchte Störung und deren Relevanz berücksichtigt (Maxim et al. 2014).
Von einem Bodeneffekt und einem Deckeneffekt spricht man in der Testpsychologie dann, wenn die zu messende Größe den Empfindlichkeitsbereich eines Messverfahrens unter- bzw. überschreitet. Ein sehr eingängiges Beispiel sei die Prüfung der Mobilität durch z. B. den Timed-up-and-go-Test. Dieser valide Test würde bei Bettlägerigen oder immobilen Patienten immer einen zeitlich unendlich hohen Wert ergeben. Soll bei diesen Patienten die verbliebene Mobilität bestimmt werden, dann werden Testverfahren benötigt, die eine geringere Mobilität – z. B. das selbstständige Drehen im Bett – erfassen. Boden- oder Deckeneffekte lassen sich leicht erkennen. Dazu wird in einem Patientenkollektiv die Verteilung der Testergebnisse untersucht. Der Anteil der minimalen und maximalen Werte darf dabei einen Anteil von jeweils 15 % nicht überschreiten. Die Messung von Veränderungen macht zudem die Festlegung einer minimal bedeutsamen Veränderung erforderlich. Nur so kann ein klinisch relevanter Effekt erfasst werden.
Eine relevante Veränderung wird als minimal clinical important difference (MCID) bezeichnet. Hier sind verschiedene Bestimmungsmethoden verfügbar. Der am häufigsten verwendete Parameter ist eine Veränderung eines Testergebnisses um wenigstens eine halbe Standardabweichung aller Testergebnisse in einer Population.
Unter der Reliabilität (Zuverlässigkeit) wird die formale Genauigkeit eines Testverfahrens verstanden. Die Reliabilität beschreibt den Anteil an der Varianz, der durch tatsächliche Unterschiede im zu messenden Merkmal und nicht durch Messfehler erklärt werden kann.
Die Validität (Gültigkeit) ist ein Maß dafür, ob die bei der Messung erzeugten Daten die zu messende Größe repräsentieren, denn nur dann können die Daten sinnvoll interpretiert werden. Validität bezeichnet also die inhaltliche Übereinstimmung einer empirischen Messung mit einem logischen Messkonzept. Allgemein ist dies der Grad an Genauigkeit, mit der das Merkmal tatsächlich gemessen wird, welches auch gemessen werden soll.
Normierung bezeichnet in der medizinischen Diagnostik ein Verfahren, das es ermöglicht, die individuellen Testergebnisse mit denen einer größeren und meist repräsentativen Stichprobe zu vergleichen. Durch die Normierung eines Testverfahrens können zum Beispiel Perzentilen erstellt werden, die dann ein individuelles Testergebnis einordnen lassen. Das Gütekriterium der Objektivität bezeichnet die Unabhängigkeit der Ergebnisse von den Personen, die bei der Ergebniserstellung beteiligt sind.
3 Das Assessment in der Geriatrie
3.1 Allgemeines zum geriatrischen Assessment
Das Assessment ist ein längerer diagnostischer Prozess, der eine umfassendere Abbildung der Probleme und Ressourcen eines alten Menschen ermöglicht. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil Symptome und gesundheitliche Probleme im höheren Lebensalter oft atypisch präsentiert oder bagatellisiert werden. Damit besteht die Gefahr, dass im Rahmen der üblicherweise durchgeführten medizinischen Diagnostik relevante Probleme übersehen werden.
Das geriatrische Assessment wurde als ein umfassender multidimensionaler und strukturierter Prozess entwickelt. Es soll bei der Entscheidungsfindung helfen, in wieweit therapeutisch präventiv, restituierend oder kompensatorisch erfolgsversprechend behandelt werden kann. Dabei werden die Wünsche und Ziele des Patienten immer mit in ein umfassendes Behandlungskonzept integriert.
Ein so aufgebauter strukturierter Prozess benötigt Zeit und dauert im Durchschnitt ca. 60 Minuten pro Patient. Daher müssen bei der Durchführung eines geriatrischen Assessments immer auch die Belastung des Patienten und seine Ausdauer berücksichtigt werden. Nicht immer kann eine Abklärung als Ganzes erfolgen, sondern muss unterbrochen werden und in kleineren Einheiten erfolgen (sog. rolling assessment), um valide Ergebnisse zu liefern.
Diese Problematik muss unbedingt erkannt und dokumentiert werden, denn ein unter starren äußeren Vorgaben zeitlich komprimierter Assessmentprozess kann falsche Eindrücke liefern und zu falschen Konsequenzen führen.
Nicht jeder ältere Mensch benötigt ein umfassendes geriatrisches Assessment. Die Auswahl der Patienten basiert auf der Zielsetzung des Assessments. Das Spektrum reicht dabei vom Erhalt der Funktionalität bei bisher nicht eingeschränkten Personen über die Aufdeckung latenter Defizite bis hin zur Quantifizierung prävalenter Einschränkungen.
Ältere Menschen, die im Alltag komplett selbstständig sind und keine relevanten Einschränkungen haben, sind eine ideale Zielgruppe für eine Prävention. Hier wäre ein umfassendes geriatrisches Assessment zu umfangreich. Auch die Konsequenzen des Assessments wären gering. Daher ist die Herangehensweise hier ein gezieltes Screening mit sich anschließendem umfassenderen Assessment nur bei Auffälligkeiten.
Auch Personen mit andauernder erheblicher Pflegebedürftigkeit würden im ambulanten Bereich weniger vom Ergebnis eines umfassenden geriatrischen Assessments profitieren. Die älteren Personen mit dem höchsten Benefit leiden typischerweise an mehreren Erkrankungen und therapiebaren funktionellen Einschränkungen (Stijnen et al. 2014).
Eine weitere Gruppe mit Benefit sind elektive chirurgische oder onkologische Patienten vor einer Intervention. Das Ziel ist hier, im Vorfeld Risikofaktoren für einen ungünstigen periinterventionellen Verlauf zu identifizieren und präventiv zu behandeln (Partridge et al. 2014).
Die entscheidende Frage lautet, welchen Benefit der Patient von einem geriatrischen Assessment hat? Studien zeigen zum Beispiel, dass ältere Menschen mit Multimorbidität von einem faktorisolierenden medizinischen Ansatz, der sich nur auf eine einzelne Erkrankung konzentriert, nicht profitieren (Gates und Mills 2005). Ein geriatrisches Assessment ist hingegen umfassender und thematisiert die für den alten Menschen relevanten Probleme unabhängig von der vorliegenden Multimorbidität.
So ließ sich zeigen, dass zu Hause lebende Personen mit pflegerischer Versorgung eine höhere Lebensqualität hatten und seltener in ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim aufgenommen werden mussten, wenn zuvor ein geriatrisches Assessment mit entsprechenden gezielten Interventionen erfolgte. Auch die Mehrkosten für diese Intervention waren durch diese günstigen Effekte mehr als ausgeglichen (Ekdahl et al. 2016).
Eine weitere wichtige Frage ist die, welche Inhalte ein umfassendes geriatrisches Assessment haben muss, um einerseits effektiv zu sein und andererseits nicht durch unnötige Ausdehnung den Patienten und den Untersucher zu überfordern.
Folgende Risikofaktoren für Funktionsverlust muss ein Assessment adressieren:
• Funktionelle Probleme
• Kognitive Probleme
• Emotionale Probleme
• Soziale Probleme
• Probleme mit der Sinneswahrnehmung
• Ungünstige und ungesunde Lebensweise
Eine Untersuchung alter Menschen lieferte durch deren Befragung die Bereiche (Domänen), die diesen Menschen aus ihrer Perspektive wichtig waren und bisher nicht ausreichend berücksichtigt wurden (sog. unmet needs). Hierzu gehörten Einschränkungen von Hör- und Sehvermögen, physische Fähigkeiten einschließlich der Aktivitäten des täglichen Lebens, Inkontinenz, Hirnleistung (Kognition), Mobilität, Sturzrisiko sowie Stimmung (Iliffe et al. 2004).
Читать дальше