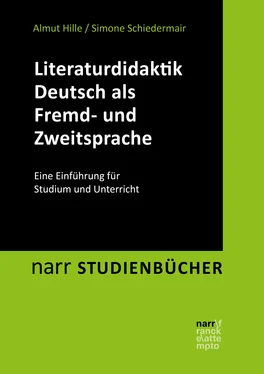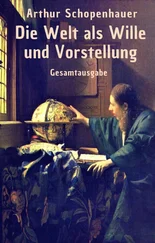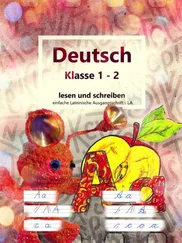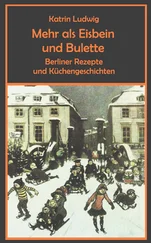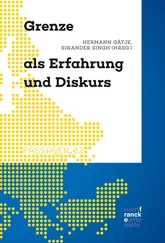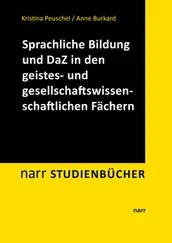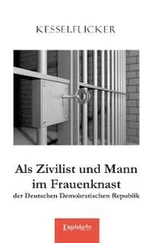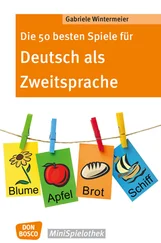Die literaturwissenschaftlich fundierte Vermittlungstätigkeit bildet das Zentrum der Literaturdidaktik. Ohne den ‚Gegenstand‘ Literatur und die systematische Erforschung seiner historischen, ästhetischen, kulturellen und kommunikativen Dimensionen wird wissenschaftliches Bemühen in diesem Bereich belanglos. (ebd.: 15f.)
Gegen die benannten Positionen gibt es Vorbehalte. In kritischer Bezogenheit auf die Überlegungen von Bogdal (2012) formuliert Volker Frederking (2014), dass die „Deutschdidaktik kein Appendix der Fachwissenschaft, keine Germanistik ‚light‘“ (ebd.: 110) sei. Vielmehr habe die Deutschdidaktik ihre eigenen Forschungsinteressen und müsse dafür auch eigene Methoden entwickeln. Insbesondere muss die Perspektive auf den Lerngegenstand „Literatur“ durch die Perspektive auf die „Lernenden“ ergänzt werden. Er formuliert als grundlegende These:
Deutschdidaktische Forschung setzt die stetige Oszillation zwischen fachlichem Lerngegenstand und fachspezifischen Lehr-Lern-Prozessen voraus. Deutschdidaktik ist in diesem Sinne die Wissenschaft vom fachspezifischen Lehren und Lernen im Zusammenhang mit deutscher Sprache, Literatur und anderen Medien. (ebd.)
Nach Frederking wäre die Deutschdidaktik als transdisziplinäre Wissenschaft zu verstehen, die zwischen der Germanistik und anderen Fachwissenschaften angesiedelt ist. Sie fokussiert fachliche Lerninhalte, fachspezifische Lehr-Lern-Prozesse, Lehrende und Lernende (ebd.: 111). Dabei ist vor allem der empirische Zugang zur Erforschung von Lehr- und Lernprozessen entscheidend:
Eine Deutschdidaktik, die sich als Wissenschaft versteht und als Wissenschaft ernst genommen werden will, muss überprüfte Theorien und abgesichertes Wissen generieren. Als Wissenschaftler müssen wir schlicht wissen, ob das, was wir theoretisch modellieren und als praxistauglich empfehlen, tatsächlich die erhofften Wirkungen zeitigt. Diesem Erfordernis kann nur auf empirischer Basis entsprochen werden. (ebd.: 115)
Von einer anderen Seite als Frederking kritisieren auch Ulf Abraham und Matthis Kepser in ihrer 2005 erstmals erschienenen und seit 2016 in vierter Auflage vorliegenden Einführung Literaturdidaktik Deutsch die Gegenstandsorientierung von Paefgen (2006) und Bogdal (2012). Sie nehmen Literatur als „Handlungsfeld“ (Abraham/Kepser 2016: 20) zum Ausgangspunkt ihrer Argumentation für eine sinnvolle Perspektive einer Literaturdidaktik: „Ihr kann es nicht in erster Linie darum gehen, wie Literatur beschaffen ist. Sie muss sich vor allem dafür interessieren, was Menschen damit machen und warum.“ (ebd.) Explizit setzen sie sich von den Positionen von Paefgen (2006) und Bogdal (2002)3 ab: Sie verstehen „Literaturdidaktik als eigenständige kulturwissenschaftliche Disziplin […]. Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik sind einander benachbarte, aber nicht auseinander ableitbare Disziplinen.“ (Abraham/Kepser 2009: 47f.)4
In der fremdsprachendidaktischen Forschung, besonders in der Fachdidaktik Englisch und auch Romanistik werden in jüngerer Zeit gerade die Transdisziplinarität und die kulturwissenschaftliche Orientierung einer Literaturdidaktik betont. Die Literaturwissenschaft wird als enge Bezugswissenschaft einer Literaturdidaktik angenommen, die sich in steter Auseinandersetzung mit neuen literatur- und kulturwissenschaftlichen Positionen und vielfältigen Lehr- und Lernprozessen dynamisch weiterentwickelt (siehe etwa Bredella/Delanoy/Surkamp 2004: 8, Freitag-Hild 2010: 9ff., Küster 2003). In dem von ihnen herausgegebenen Band Literaturdidaktik im Dialog bezeichnen Lothar Bredella, Werner Delanoy und Carola Surkamp (2004: 9) als wichtige Entwicklungsfelder der Literaturdidaktik beispielhaft eine gender-bezogene Fundierung der Vermittlung von Literatur, einen weiten Literaturbegriff und eine Aufgabenorientierung.
Eine Literaturdidaktik des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprachewie sie diesem Band zugrunde gelegt wird, knüpft an die dargestellten Forschungsdiskussionen an. Sie
betrachtet Literatur als Gegenstand institutionalisierter Lehr- und Lernprozesse, auf den mit den Grundlagen und Methoden einer (kulturwissenschaftlich orientierten) Literaturwissenschaft zugegriffen wird;
modelliert und erforscht (empirisch) fachspezifische Lehr- und Lernprozesse in ihren vielfältigen Komponenten wie Lernziele, Handlungsformen, Lehrende und Lernende.
Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik werden so als zwei eng miteinander verbundene Wissenschaften verstanden, die Fragestellungen und Analysekategorien zum Gegenstand Literatur teilen.
Diese Einführung verfolgt nicht das Anliegen, eine ‚eigenständige‘ Literaturwissenschaft für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, wohl aber eine fachspezifische Literaturdidaktik zu etablieren.
Die Formung einer ‚eigenständigen‘ Literaturwissenschaft für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache wurde in Forschungsbeiträgen immer wieder gefordert (vgl. Dobstadt 2009: 21ff., Altmayer 2014: 34). Aber worin soll sie bestehen? Unserem Verständnis nach ist es – wie in den oben dargestellten Positionen einer Fachdidaktik Deutsch wie Fachdidaktik Englisch ebenfalls deutlich wird – die Literaturwissenschaft an sich, deren Grundlagen und Methoden für einen didaktischen Umgang mit Literatur auch im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache relevant sind.
Literaturmüsse als Literaturernst genommen und vermittelt werden – diese Forderung wird in der fachwissenschaftlichen Diskussion seit 2010 immer deutlicher formuliert. Verschiedene (neue) Konzepte nehmen die literarischen Texte als solche verstärkt in den Blick. Sie legen den Fokus auf
die Rolle der Form für deren (Be-)Deutung (form as meaning),
Medialität,
Deautomatisierung,
diskursive Vernetzung und
die Partizipation an fremdsprachigen Diskursen als übergreifender Zielsetzung des Fremd- und Zweitsprachenunterrichts.
Im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache wird dieser Entwicklung in hohem Maße Rechnung getragen; sie ist forschungsleitend in den letzten Jahren. Das betont aus anglistischer Sicht auch Laurenz Volkmann (2015) und hebt die jüngeren Beiträge der fachwissenschaftlichen Diskussion in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache diesbezüglich als vorbildlich hervor:
Sie drehen ein oft vernommenes Hauptargument gegen den Einsatz von Literatur im Fremdsprachenunterricht bzw. für eine Reduktion von literarisch-ästhetischen Elementen gewissermaßen um. Nicht allein als fiktionaler Steinbruch für landeskundliche Phänomene oder interkulturelle Fremderfahrung habe Literatur zu wirken, sondern – im Gegenteil – Literatur solle im Mittelpunkt eines […] Unterrichts stehen. (Volkmann 2015: 367)5
Mit dieser Betrachtung rücken andere, im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ebenfalls vertretene Positionen in den Hintergrund, die literarische Texte zunächst als Medien für sprachliches und kulturelles Lernen auffassen. In dieser Perspektive werden literarische Texte hauptsächlich in entsprechenden Bedingungsgefügen gesehen. Für das sprachliche Lernen (→ Kap. 6) wird etwa hervorgehoben, dass literarische Texte für die Präsentation und Übung eines grammatischen Phänomens von Bedeutung sein können; eine Position, die sich auch in vielen Lehrwerken findet. Auch die Beschäftigung mit einem Aspekt wie der Literarizität von Texten generell, den literarische Texte jedoch in besonders auffälliger Weise ausstellen, kann in dieser Perspektive sprachliches Lernen fördern.
Mit dem Fokus auf dem kulturellen (bzw. landeskundlichen) Lernen werden die Lektüren literarischer Texte mitunter den Kulturstudien, der Kulturvermittlung bzw. Landeskunde im Fach subsumiert (→ Kap. 7), in besonderem Maße werden literarische Texte im Fokus des interkulturellen Lernens betrachtet (→ Kap. 8).
Читать дальше