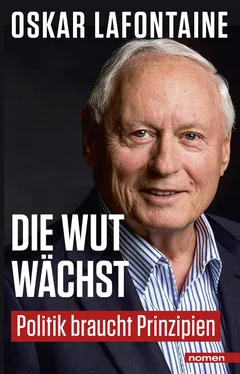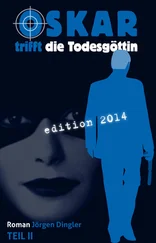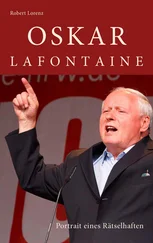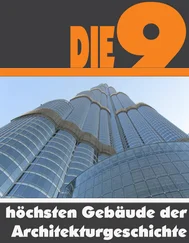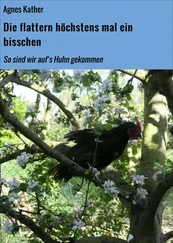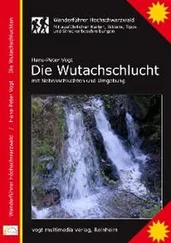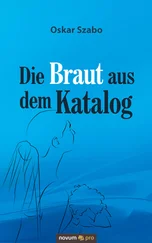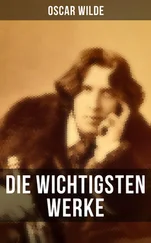Um im Nahen Osten die Säkularisierung zu unterstützen, sollte der Türkei – wenn sie zusagt, künftig die Menschenrechte zu beachten – eine enge Zusammenarbeit mit Europa angeboten werden. Sie wäre ein Brückenkopf Europas in der muslimischen Welt. Die Türkei verdient auch deshalb unsere Hilfe, weil sie ihr Modell der Trennung von Staat und Religion in die turksprachigen Staaten Mittelasiens exportieren will. Wäre die Säkularisierung ein Ziel der westlichen Außenpolitik, dann hätte es die Unterstützung der Taliban seitens der Vereinigten Staaten über mehrere Jahre hinweg nicht gegeben. Besonders die Frauenbewegung in Amerika hat darauf hingewiesen, dass es in Afghanistan nicht nur um Pipelines, sondern auch um die Rechte der Afghaninnen gehen sollte. Wichtig ist, dass diese nicht als Mittel zum Zweck missbraucht werden. Oft genug stehen hinter einer vordergründigen Verteidigung der Menschenrechte wirtschaftsund machtpolitische Interessen. Die Gleichstellung der Frauen in Beruf und Gesellschaft muss Bestandteil der neuen Weltordnung werden.
Der Fall der Mauer und der Zusammenbruch der kommunistischen Staaten fiel in die Ära des Neoliberalismus. Mit dem Amtsantritt von Margaret Thatcher in England und Ronald Reagan in Amerika hatte sich in der westlichen Welt der Marktfundamentalismus durchgesetzt. Die Individuen sollten auf der Basis von Privateigentum einen vom Staat möglichst wenig eingeschränkten Handlungsspielraum haben. Privatisierung, Deregulierung und Flexibilisierung waren die Heilsbotschaften dieses neuen Dogmatismus. Hatte man es im Wettbewerb mit dem östlichen Kommunismus noch für notwendig angesehen, der Marktwirtschaft den Sozialstaat zur Seite zu stellen, so gab es nach dem Zusammenbruch des Ostblocks kein Halten mehr. Nicht mehr von Menschen war die Rede, sondern nur noch von Marktpreisen und Kosten. Ein neuer Totalitarismus, ein menschenverachtender Ökonomismus, wurde zur globalen Leitkultur. Aber die Ökonomisierung der Gesellschaft ist ein Weg in die Barbarei. Der Sozialstaat wurde zur überflüssigen Einrichtung erklärt, die abgebaut werden müsse. Auch sozialdemokratische Parteien und Gewerkschaften verfielen mehr und mehr dem neoliberalen Paradigma. Die Entsolidarisierung der westlichen Gesellschaften setzte ein, die Idee der Solidarität schien ihren Glanz verloren zu haben. Ein verkürztes Verständnis von Modernisierung machte sich breit. Ging es früher darum, sich aus traditionellen Bindungen zu lösen, um freier und mündiger zu werden, so geht es heute um die Anpassung der Politik an die Zwänge des internationalen Wettbewerbs. Unter Modernisierung werden jetzt Maßnahmen verstanden, die die Möglichkeiten der Menschen zu einem freien selbstbestimmten Leben erheblich einschränken. Im Zentrum wirklicher Reformpolitik steht die Freiheit des Menschen. Modernisierung ist ein anderes Wort für Emanzipation, nicht für Profit, Shareholdervalue und neue Abhängigkeit.
Solidarität in unserer Zeit heißt immer auch Verantwortung für kommende Generationen. Ihnen wollen wir eine Welt hinterlassen, in der man das Wasser noch trinken und die Luft noch atmen kann und deren Böden noch fruchtbar genug sind, um die Menschheit zu ernähren. Die Welt braucht eine umweltverträgliche Energiepolitik und die reichen Länder müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist daher ein Hoffnungszeichen, dass im Jahre 2001 mehr als 100 Staaten in Marrakesch ein UNO-Abkommen zur Einschränkung der Treibhausgasemissionen getroffen haben, um die Erderwärmung zu verlangsamen. Der Vertrag wurde von den Vereinigten Staaten nicht unterschrieben – obwohl in keinem Land der Welt der Ausstoß von Treibhausgasen so hoch ist. Dem Ereignis kommt deshalb besondere Bedeutung zu, weil die Völkergemeinschaft auch dann zu globalen Vereinbarungen fähig ist, wenn die einzig verbliebene Supermacht nicht mitwirkt. Auf Dauer werden die Vereinigten Staaten jedenfalls ihre isolierte Position in der Welt nicht durchhalten können.
Langfristig ist nur eine Politik erfolgreich, die sich auf klare Grundsätze stützt und diese auch dann beherzigt, wenn ihre Missachtung von außen betrachtet kurzfristige Scheinerfolge bringt. An der Utopie der Aufklärung, der Weltgesellschaft der Freien und Gleichen müssen wir uns weiter orientieren. In der Weltgeschichte gibt es den Kairos, den richtigen Zeitpunkt. Wird der amerikanische Präsident George W. Bush die Chance erkennen und einen Beitrag zum Entstehen einer gerechteren Weltordnung leisten? Denkt er überhaupt darüber nach, warum sein Land mit 4,5 Prozent der Weltbevölkerung 25 Prozent der gesamten Erdölförderung verbraucht, 40 Prozent der Militärausgaben der Welt in seinen Haushalt stellt, für 50 Prozent aller Waffenexporte verantwortlich ist und, obwohl es zu den reichsten Ländern gehört, 64 Prozent des auf den Weltmärkten angebotenen Kapitals zur Verbesserung seines Lebensstandards benötigt? Bisher spricht vieles dagegen. Bush hatte mit einem »compassionate conservatism«, einem mitfühlenden Konservatismus, Wahlkampf gemacht.
Als seinen Lieblingsphilosophen nannte er Jesus. Und er ließ die Welt wissen, seine Kraft und seinen Optimismus ziehe er aus seinen Gebeten. Bush ist von missionarischem Eifer erfüllt, das Böse auszurotten. Seit dem 11. September, so las man in der New York Times, sieht er sich als Werkzeug Gottes. Dafür halten sich auch die muslimischen Selbstmordattentäter. So wie Bush von der »Achse des Bösen« spricht, so nennen sie die USA den »großen Satan«.
Werden auf der anderen Seite die Europäer, deren Kontinent die Philosophie der Aufklärung hervorgebracht hat, ihre Rolle in der neuen Weltordnung finden? In keinem Fall dürfen sie der Versuchung erliegen, den USA beim Aufbau einer globalen Militärmacht nachzueifern. In der Welt gibt es viele Waffen, aber zu wenig Hilfe für die Hungernden und Unterdrückten. Auch in der Weltpolitik sollte Immanuel Kants kategorischer Imperativ Geltung haben: »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde.« Würden alle Staaten das Völkerrecht missachten, Atomwaffen produzieren, Waffen exportieren und so viel Energie verbrauchen, wie die Industriestaaten, dann wäre die Welt bereits zerstört. In ethischer Hinsicht sind die entwickelten Länder, allen voran die Vereinigten Staaten, unterentwickelt. Eine gerechte Weltordnung setzt voraus, dass die reichen Länder lernen, mit den ärmeren Solidarität zu üben. Dabei müssen sie ihre Ansprüche zurücknehmen. Das gilt vor allem für Amerika, das seinen Willen zur Weltherrschaft aufgeben und zu partnerschaftlicher internationaler Zusammenarbeit bereit sein muss. Der Anschlag vom 11. September hat die großen Stärken und Schwächen der Vereinigten Staaten noch einmal jedem vor Augen geführt.
Gebt mir Eure Müden, Eure Armen, Eure bedrängten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen, das elende Strandgut Eurer überbevölkerten Gestade. Schickt sie, die Heimatlosen, die Sturmverwehten zu mir, ich erhebe meine Lampe am goldenen Tor.« Diese bewegenden Worte stehen auf dem Sockel der amerikanischen Freiheitsstatue. Die Vereinigten Staaten sind eine Nation von Einwanderern.
Sie mussten stets gegen Beschränktheit und Fremdenfurcht kämpfen. Immer wieder haben sie Zuwanderer aufgenommen, deren Ideen, Werte, Traditionen und Lebensart verschieden waren. Die Bürgerinnen und Bürger der USA lernten mit Menschen zusammenzuleben, die aus anderen Kulturkreisen kamen. Nirgendwo erlebt man das so beeindruckend wie in New York. Der Terroranschlag vom 11. September erschütterte das Land in seinem Selbstverständnis. Die Gewissheit, unangreifbar und unbesiegbar zu sein, wich einem Gefühl der Angst. Vier amerikanische Passagiermaschinen waren von arabischen Terroristen gekapert worden. Zwei wurden in die Türme des World Trade Centers gelenkt. Eine Maschine stürzte auf das Pentagon. Das vierte Flugzeug verfehlte sein Ziel. Es sollte den Landsitz des amerikanischen Präsidenten, Camp David, zerstören. Nach einem Handgemenge zwischen Terroristen und Passagieren stürzte diese Maschine in Pennsylvania ab. Mit großem Erstaunen las ich kurz nach den Anschlägen ein Gedicht, das Erich Kästner 1930 geschrieben hat. Hier ein Auszug:
Читать дальше