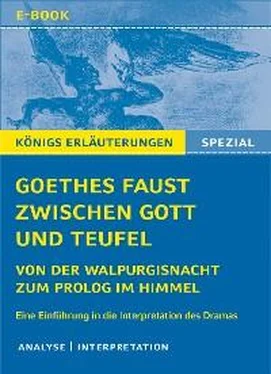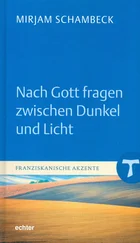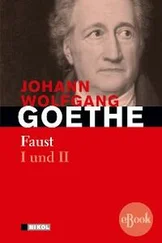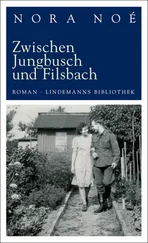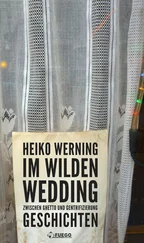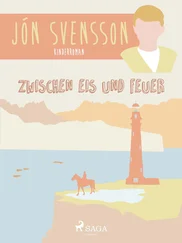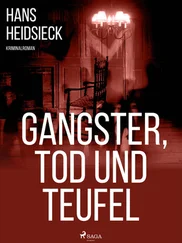Ein denkbarer Hinweis
Die Walpurgisnacht -Szene als Schlüssel zu Faust?
Das Gespräch an jenem Sommertag mit Johannes Falk wandte sich bald dem Faust und besonders der Szene Walpurgisnacht zu. Es deutet entscheidende Überlegungen Goethes zum Drama an sowie den Entschluss, einem Streit mit dem ungeliebten und kritiksüchtigen Publikum auszuweichen – durch Selbstzensur. Auch wenn man annehmen muss, dass Goethe einen schlechten Tag hatte und manches übertrieben formulierte, so ändert das nichts an der Tatsache, dass er sich schon seit längerem vom deutschen Publikum unverstanden fühlte. Es scheint sich zu lohnen, den Andeutungen Goethes nachzugehen, um zu sehen, ob sich dadurch nicht ein anderes Verständnis des Werks ergibt.[3]
Noch eine Faust -Deutung?
Selbstverständlich ist mir bewusst, dass der Faust seit mehr als 200 Jahren Zuschauer:innen und Leser:innen fasziniert und für derart viele Veröffentlichungen gesorgt hat, dass kein Menschenleben ausreicht, auch nur einen Bruchteil davon zu lesen. Man findet vielleicht noch nicht einmal genau heraus, was zu einer bestimmten Überlegung wo bereits in ähnlicher Form steht, so viel ist geschrieben worden. Und natürlich gibt es auch nicht den einen und besonderen Ansatz, um dieses reiche Werk zu begreifen.
Vorgehensweise
Gedanklicher Reichtum Goethes
Zur Vorgehensweise: Die vorliegende Erläuterung ist für die Schule gedacht. Es soll sich zeigen, dass bewährte Textarbeit eine sicherlich aufwändige, aber bestimmt erfüllende Vorgehensweise ist, um sich einem kompliziert und schwer verständlich erscheinenden Werk zu nähern. Selbst wenn man dabei an Grenzen stößt, so sind der gedankliche Reichtum und die sprachlichen Finessen Goethes diese Mühen allemal wert. Man kann nur für sich selbst gewinnen. Die methodischen Kriterien für literarische Interpretationen werden deshalb zunächst vorgestellt. Der Analyse liegt aus praktischen Gründen die gängige Textausgabe von Goethes Faust. Der Tragödie Erster Teil von Reclam XL Nr. 19152 zugrunde (seiten- und zeilenidentisch mit RUB Nr. 1), hrsg. von Wolf Dieter Hellberg, Stuttgart/Ditzingen 2014.
| 2. |
Eine kurze Einführung in die Interpretation literarischer Werke |
Text als Medium
Verarbeitung menschlicher Erfahrungen
Auch wenn (ältere) literarische Texte mitunter sprachlich und thematisch schwer zugänglich erscheinen, ändert es nichts an der Tatsache, dass sie wie alle Texte verstanden werden wollen. Es spielt auch keine große Rolle, ob es sich um einen erzählerischen, lyrischen oder Dramentext handelt. Ein literarischer Text wurde in der Regel mit dem Wortschatz einer bestimmten Sprache verfasst, gehorcht den Regeln der Grammatik und bedient sich verschiedener Gestaltungsmittel, um seine Botschaften zu vermitteln und etwas zum Ausdruck zu bringen. Alle Regelabweichungen haben eine Bedeutung. Der Text ist das Mitteilungsmedium zwischen Autor:in und Leser:in, die beide für gewöhnlich einen Großteil des gleichen Sprachwissens und oft genug ähnliche Erfahrungen teilen. Der Autor oder die Autorin eines Textes nutzt dieses Medium, um grundlegende menschliche Erfahrungen wie Liebe, Schmerz, Glück oder Unglück zu verarbeiten.
Es ist sehr bedauerlich und mit Sicherheit auch falsch, wenn man vor einem Gedicht, Drama oder anderen Texten Goethes zurückschrecken würde und sich damit tröstet, dass es vom großen Herrn Goethe stamme und einem zu hoch sei. Goethe hat ausgesprochen bissige Kommentare für diejenigen parat, die etwas allzu kompliziert behandeln. Und nach etwas Zeit zum Einlesen geht man so gut wie immer mit einem Erkenntnisgewinn aus der Beschäftigung mit seinen Texten heraus. Zugegebenermaßen gehört ein wenig Durchhaltewillen zum Geschäft; so wie die Zeit zum Wandern, wenn man das Ziel erreichen möchte.
Verallgemeinerbare Kriterien
Spezifische Gattungsunterschiede
Es ist sinnvoll, von verallgemeinerbaren Analysekriterien auszugehen, eben weil Texte gleich welcher Form letztlich Texte sind. Die Kriterien können gegebenenfalls um die wenigen Aspekte ergänzt oder abgeändert werden, die sich aus den spezifischen Unterschieden der Literaturgattung herleiten. Zum Drama fallen einem beispielsweise Auffälligkeiten in der Makrostruktur ein, wie die Einteilung in Akte, Szenen, Orte, Figuren oder das Verhältnis von Haupt- und Nebentext.
Lektüretipp
Es gibt viele vorzügliche Bücher, die in die Interpretationsmethodik einführen, sodass es beinahe ungerecht wäre, wenn man auf ein bestimmtes Werk verweist und andere nicht nennt. Ich persönlich, und das ist wirklich rein subjektiv, hatte mein sog. Aha-Erlebnis nach der Lektüre von Bernd Matzkowskis Bänden mit dem Titel Wie interpretiere ich? , ergänzt um die jeweilige Gattung, also beispielsweise Wie interpretiere ich ein Drama? In ihnen wird eine grundsätzliche Vorgehensweise vorgestellt. Generell ist man gut beraten, sich im Wesentlichen an die folgenden Analyseschritte zu halten[4]:
Acht Analyseschritte
1 Das allgemeine Thema/Problem des Textes erkennen, was nicht den Inhalt meint, sondern das dem Inhalt Übergeordnete, das durch den Inhalt zum Ausdruck gebracht wird.
2 Das inhaltliche Geschehen, den Handlungsablauf verstehen und ggf. Unklarheiten beseitigen.
3 Den allgemeinen Aufbau des Textes und die damit verbundene Funktion beschreiben.
4 Die Wortwahl eines Textes untersuchen, Auffälligkeiten festhalten und die Funktion der Auffälligkeiten erklären.
5 Die grammatische Gestaltung des Textes beschreiben und die Funktion für den Text und seine Wirkung erläutern.
6 Literarische bzw. rhetorisch-stilistische Gestaltungsmittel erkennen und ihre Funktion innerhalb des Textes verständlich machen.
7 Die Aussageabsicht des Textes zusammengefasst darlegen.
8 Ergänzend über den eigentlichen Text hinausgehende Fakten, die mit ihm aber in einer konkreten Beziehung stehen, bedenken, z. B. biografische, historische oder literaturgeschichtliche Bezüge.
Die jeweiligen Elemente stehen in einer Wechselwirkung und tragen auf ihre Weise dazu bei, eine bestimmte Stimmung zu vermitteln, eine Situation zu veranschaulichen oder einen Charakter näher zu gestalten. Diese Vorgehensweise ist nie verkehrt, egal welcher literarische Text vor einem liegt. Die Probleme entstehen, wenn man in der Analyse sachliche Fehler macht, etwas unangemessen gewichtet oder überzogene Behauptungen aufstellt. Leider muss man zugeben, dass es keinen goldenen Weg und keine Musterlösung im interpretatorischen Umgang mit Literatur gibt. Das ist die große Herausforderung. Es ist übrigens nicht das schlechteste Zeichen, wenn jemand nach einer gewissen Zeit die Dinge anders bewertet oder bestimmte Formulierungen so nicht mehr vornehmen würde.
Schwierigkeiten der Bewertung
Warum es die Mathematik leichter hat
Die Mathematik hat es besser: Innerhalb ihres Regelwerkes sind mitunter verschiedene Lösungswege denkbar und richtig, andere dagegen eindeutig falsch. Ein Interpretationsaufsatz ist dagegen quasi eine komplexe schriftliche Mitteilung zu einer Fragestellung und die Rückmeldungen von Leser:innen, sei es in Form von Noten, Kommentaren oder Rezensionen, immer eine subjektive Einschätzung. Obwohl es innerhalb eines Aufsatzes objektiv Richtiges und Falsches gibt, ist das Gesamtbild für den Bewerteten mitunter eine Überraschung, weil auch die sprachliche Eleganz oder das Ausmaß der Sprachrichtigkeit eine Rolle in der Bewertung spielen.
Erste Eindrücke
Hilfreiche Erkenntnisse
Zum Faust würden aufmerksame Schüler:innen gewissen Alters nach einer ersten Lektüre gemäß der oben genannten Kriterien auf Anhieb einige hilfreiche Erkenntnisse festhalten können. In etwa so:
Die Tragödie behandelt die menschliche Sehnsucht nach Erkenntnis und Lebensglück. Dabei werden auch andere Themen berührt (Vorgehensweise s. o., Punkt 1).
Читать дальше