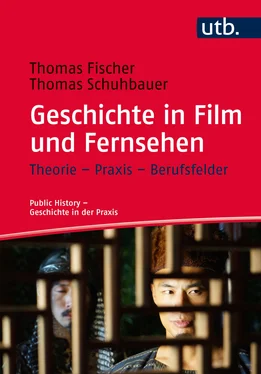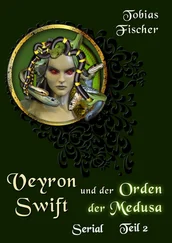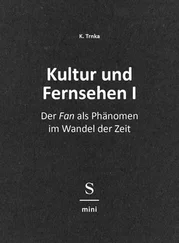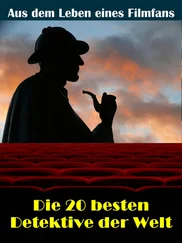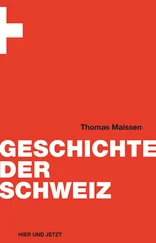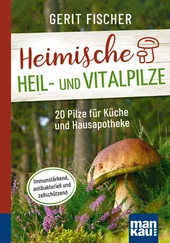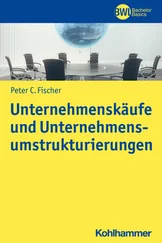Ausgangspunkt waren Forschungen von Aleida und Jan Assmann in den 1980er Jahren zum kulturellen und zum kommunikativen Gedächtnis. Das kulturelle Gedächtnis stand dabei als „Sammelbegriff für alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung ansteht.“ (Assmann 1988, 9) Zum ‚Wissen‘ gehört somit auch das über Generationen tradierte geschichtliche Wissen, das in großem Maße auf (erforschten) Erzählungen beruht. Das kommunikative GedächtnisKommunikatives Gedächtnis ist demgegenüber weniger festgelegt und organisiert. Es ist noch im Fluss und unfertig wie die Erinnerung (ebd. 10). Im Unterschied zur Alltagsferne des kulturellen Gedächtnisses ist es an Personen und Erfahrungen gebunden und durch Alltagsnähe gekennzeichnet. Das kommunikative Gedächtnis beruht auf mündlicher Kommunikation und lässt sich als fortlaufender Prozess des Erzählens verstehen. Es hat keinen festen Zeithorizont, sondern durchwandert gewissermaßen die Lebenszeit der Erzählgemeinschaften. Jan Assmann geht davon aus, dass das kommunikative GedächtnisKommunikatives Gedächtnis 80 bis 100 Jahre, also etwa drei Generationen umfasst. Es funktioniert als eine Art kommunikativer Arbeitsspeicher der Gesellschaft, in dem Erzählungen über Gegenwart und Vergangenheit kursieren, temporär gelagert und immer wieder ergänzt und umgeschrieben werden. Die kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung hat das Gedächtnis zunächst hauptsächlich als Speichermedium für Wissen und Erzählungen betrachtet und sich für seine Funktion als Verbreitungsmedium von Wissen und [7]Erzählungen weniger interessiert. Das betraf auch die Geschichtsfilme im Kino und Fernsehen, bei denen das Augenmerk mehr auf der Archivierung als auf der Verbreitung lag. Astrid Erll und Stephanie Wodianka haben 2008 deshalb vorgeschlagen, die Aufmerksamkeit innerhalb der kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung von den Speichermedien stärker auf die Verbreitungsmedien, von den Symbolsystemen hin zu den Sozialsystemen zu verlagern und nicht mehr allein das Produkt (Gedächtnis), sondern in erster Linie die Prozesse (ErinnerungsdiskurseErinnerungsdiskurs) der kulturellen Erinnerung zu untersuchen (Erll/Wodianka 2008a). Dadurch ließe sich feststellen, welche Erzählungen denn tatsächlich in den gesellschaftlichen ErinnerungsdiskursErinnerungsdiskurs eingegangen seien und welche nicht (Erll 2008, 16). Erste Filmanalysen, die diese neue Fragestellung nutzbar machen, liegen vor. So wurden zum Beispiel die Filme „Das Leben der Anderen“ (D 2006) von Lu Seegers (2008) und „Luther“ (USA/D/GB 2003) von Carola Fey (2008) daraufhin befragt, welche Akteure und Medien an ihrer Entstehung beteiligt sind, wie und warum sie in die gesellschaftliche Diskussion geraten und wie der Diskurs außerfilmisch (also vor, während und nach der Kinolaufzeit) in begleitenden Medien als ein dynamischer, auf lange Dauer gestellter Prozess verläuft (Plurimedialität). Erzählweisen und Erzählstrukturen An audiovisuellen Erzählungen sind nicht nur die Sozial- und Kulturwissenschaften, sondern naturgemäß auch Film-, Literatur- und Erzählwissenschaft (Narratologie) stark interessiert. Als der Film um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aufkam, wurde er von der Literaturwissenschaft anfangs nicht ernst genommen, er galt als Volksvergnügen ohne größere kulturelle Bedeutung. Zudem war ja der Roman und nicht der Film das Hauptbetätigungsfeld der Literaturwissenschaft und Erzähltheorie. Es war deshalb auch die sich herausbildende Filmwissenschaft selbst, die dem Film seit den 1920er Jahren einen Kunststatus zusprach und ihn von den literarischen Formen des Erzählens radikal abgrenzte. Dabei verwies sie auf die Tatsache, dass das Medium ‚Film‘ völlig andere Zeichen benutzt, um sichtbare Welten darzustellen, als das Medium ‚Literatur‘, nämlich bildliche statt sprachliche Zeichen. Das Visuelle und das Literarische galten als unvereinbar; showingstand gegen telling, unmittelbares Darstellen im Film gegen mittelbares Erzählen im Text (dazu Bietz 2013, 81ff.). Während der literarische Text gewissermaßen aus ‚toten‘ Buchstaben besteht und wie eine ‚Partitur‘ gelesen wird, d.h. beim Lesen von den Lesern „zur Aufführung gebracht wird“ (Seel 2013, 120), ist der Film selbst eine Aufführung, die die Zuschauer in einen raumzeitlich strukturierten audiovisuellen Geschehensablaufs hineinzieht und diesen miterleben lässt. Die mediale Kluft zwischen Film und Roman schien unüberbrückbar. Erst seit ein paar Jahren versuchen einige Literaturwissenschaftler, Filmwissenschaftler [8]und Erzähltheoretiker wieder Brücken zwischen Film und Literatur zu schlagen, indem sie darlegen, dass beide Darstellungsformen eines gemeinsam haben: das Erzählen. Diese zuletzt von Christoph Bietz in seinem Buch über „Die Geschichten der Nachrichten“ (2013) vorgeschlagene transmediale Ausweitung des Erzählbegriffs von den Literatur auf das bewegte Bild und das vermittelnde Wort von Erzählstimmen im Film, führt damit auch den filmischen Erzähler wieder mit denen zusammen, die einer audiovisuellen Erzählung zusehen und zuhören, dem Publikum. Beide treffen sich im Erzählraum des Kinos oder vor dem Bildschirm im Fernsehzimmer. Der eine erzählt in Bild und Ton eine Geschichte, die zuvor vielleicht ein historischer Roman war, und die anderen verwandeln diese Bild-Ton-Geschichte wieder in mittelbare sprachliche Erzählungen, wenn sie zu Hause oder bei der Arbeit über das Filmereignis berichten. Die Erzähltheorie interessiert sich aber nicht nur für die unterschiedlichen Modi des Erzählens (visuell vs. literarisch bzw. szenisch vs. dokumentarisch), sondern auch für das Verhältnis von Erzählung und dem ihr zugrunde liegenden Ereignis. Es geht dabei um die Frage, ob und wie Geschichtsfilme die vergangene tatsächliche Welt abbilden bzw. darstellen können. Auch hier hat zuletzt Bietz erneut klargelegt, dass es keinem audiovisuellen Medium und keinem Erzähler gelingen kann, die äußere Welt unmittelbar, objektiv, geschweige denn vollständig abzubilden. Bietz zeigt das bei der Analyse aktueller Fernsehnachrichten unter erzähltheoretischen Gesichtspunkten. Das von ihm erprobte Analyseinstrumentarium wird in diesem Buch teilweise zur Systematisierung und Analyse von Geschichtsfilmen benutzt. Film und Geschichtswissenschaft Das Medium ‚Film‘ ist von der Historiografie jahrzehntelang nicht als ‚geschichtswichtig‘ angesehen worden. Erst in den 1970er Jahren gab es in Frankreich und England Interesse von Seiten der Historiker (Marwick 1974; Ferro 1975). In den 1980er Jahren hat dann Irmgard Wilharm eine geschichtsdidaktisch orientierte Auseinandersetzung mit dem Medium ‚Film‘ in die Geschichtswissenschaft eingeführt. Sie hat Geschichtsfilme nicht nur in ihrem Bezug zur tatsächlichen Welt befragt, sondern die erzählte filmische Welt auch quellenkritisch analysiert. Im Zentrum ihrer Analysen standen mentalitätsgeschichtliche Überlegungen: die Filmbilder und die durch sie vermittelten Aussagen wurden als Quellen für Bewusstseinslagen zeitgenössischer Lebenswelten interpretiert (Wilharm 2006). Auch Anton Kaes begann in den 1980er Jahren mit der Untersuchung von Geschichtsfilmen der deutschen Nachkriegsgeschichte, beschränkte sich aber, wie andere auch, hauptsächlich auf werkimmanente Interpretationen (Kaes 1987). Ein stärkeres Historikerinteresse an Geschichtsfilmen blieb aber aus, selbst [9]dann noch, als das Fernsehen in den 1990er Jahren zum Leitmedium der populären Geschichtsdarstellung wurde. Erst nach der Jahrtausendwende begann eine breitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Geschichte in populären Medien, allerdings noch nicht grundsätzlich und systematisch, sondern bezogen auf Teilaspekte. Untersucht wurde hauptsächlich die Darstellung der NS-Zeit im deutschen Nachkriegsfilm (so z.
Читать дальше