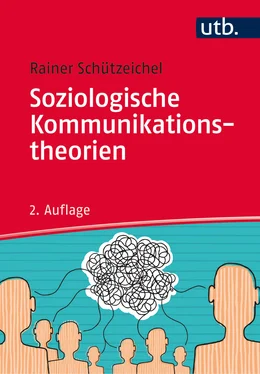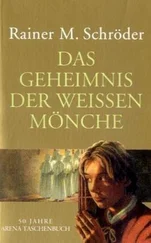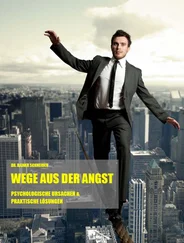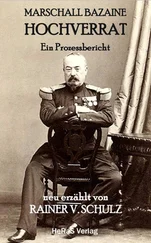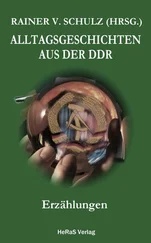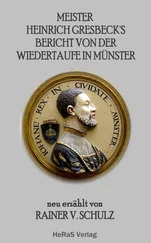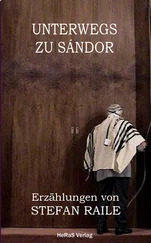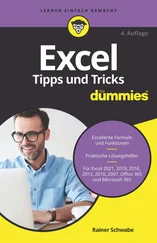Den verschiedenen soziologischen Theorien ist weniger ein bestimmtes Forschungsobjekt gemeinsam, sondern eher eine Leitfrage: Wie ist soziale Ordnung möglich? Sie lässt sich je nach Geschmack und Erkenntnisinteresse auch anders formulieren: Wie kann man soziale Beziehungen, soziale Gebilde, Institutionen, Gesellschaften oder allgemein soziale Ordnungen erklären? Oder auch: Wie ist soziales Handeln möglich, wenn denn soziales Handeln eine Orientierung an anderen Handelnden voraussetzt? Wie können Menschen ihre Handlungen koordinieren und wie können sie kooperieren? Oder in Bezug auf Kommunikation formuliert: Wie ist überhaupt Kommunikation möglich?
Dazu gehören solche Fragen wie: Wie geschieht eigentlich Kommunikation? Wie kommt Kommunikation zustande? Woraus baut sie sich auf? Wann liegt Kommunikation zwischen Menschen vor? Ist schon jede Wechselwirkung zwischen Menschen eine Kommunikation? Was unterscheidet etwa ein zufälliges Zusammenprallen zwischen Menschen auf dem Gehsteig von einem Gespräch zwischen ihnen? Welche Formen von Kommunikation kann man unterscheiden? Wie unterscheidet sich beispielsweise das Klatschgespräch im Hausflur von dem Jubel der Fussballfans beim Fallen eines Tores, das Lesen eines Buches von dem Kauf eines Buches? Handelt es sich immer um Kommunikationen? Wie stellt man das fest? Und aus welchen Komponenten besteht Kommunikation? Gibt es Komponenten, die für alle verschiedenen Kommunikationsformen maßgeblich sind?
Diese Fragen unterscheiden das Erkenntnisinteresse der Soziologie von demjenigen anderer wissenschaftlicher Disziplinen, die ebenfalls mit Kommunikation befasst sind. In dieser Einführung analysieren wir solche theoretischen Positionen, die in besonders signifikanter Weise zur Beantwortung dieser Frage ›Wie ist Kommunikation möglich?‹ beitragen können. Von daher versteht sich diese Einführung nicht nur als ein Beitrag zur Soziologie der Kommunikation, sondern auch als Einführung in soziologische Theorien oder gar in die allgemeine soziologische Theoriebildung überhaupt. Sie befasst sich mit solchen Theorien, die nicht nur an dieser oder jener spezifischen Kommunikationsform interessiert sind, sondern allgemein an der strukturellen Matrix von Kommunikation und die von daher auch für die allgemeine Theorie ein hohes Potenzial besitzen. Es geht also in dieser Einführung auch darum, den schon erwähnten communicative turn in der Soziologie ein wenig weiter zu treiben, weil nach Überzeugung des Verfassers ›Kommunikation‹ in der Soziologie dasjenige Basiskonzept darstellt, welches die höchste integrative Kraft aufweist und solche konkurrierenden Basiskonzepte wie ›Handlung‹, ›Wissen‹, ›Kultur‹ oder neuerdings ›Medien‹ nochmals zu fundieren vermag.
Wenn man sich mit Kommunikation und Kommunikationstheorien befasst, so steht man vor einem schwierigen Problem, denn es gibt eine Phalanx unterschiedlicher Theorien, die Kommunikation sehr unterschiedlich konzeptualisieren. Im Jahre 1977 konnte Klaus Merten (vgl. Merten 1977) allein im soziologierelevanten Kontext 160 verschiedene Definitionen von Kommunikation identifizieren. Und die Zahl dürfte in der Zwischenzeit sicherlich nicht abgenommen haben. Dies liegt unter anderem daran, dass ›Kommunikation‹ wie auch ›Information‹ oder ›Sprache‹ keine Begriffe im normalen Sinne sind, obwohl sie häufig als solche behandelt werden. Sie beziehen sich nicht auf anschauliche, konkret fassbare, abgrenzbare Dinge, wie dies etwa ›Buch‹, ›Haus‹ oder ›Baum‹ tun. Sie sind unanschaulich, weil sie nicht einen sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand untersuchen, sondern Gegenstände im übertragenen Sinne: Sie beziehen sich auf Formen des Handelns und der Praxis. Sie sind nicht Produkte menschlicher Praxis wie etwa Häuser oder Bücher, sondern Formen, in denen sich die menschliche Praxis vollzieht. Entsprechend schwierig ist ihre Konzeptualisierung. So lässt sich auch der Umstand erklären, dass es recht zahlreiche Vorstellungen und Theorien über Kommunikation gibt.
In diesem Kapitel müssen wir uns mit gewissen Begrifflichkeiten und Problemstellungen vertraut machen. Dazu werden wir zunächst unsere Alltagsauffassung von Kommunikation beleuchten und anschließend auf renommierte wissenschaftliche Kommunikationsvorstellungen und deren theoretische Einrahmungen zu sprechen kommen.
1.1 Alltagskonzepte
Im Alltagsleben ist eine spezifische Vorstellung über Kommunikation in besonderem Maße virulent (vgl. Fiehler 1990): Kommunikation wird häufig in Analogie zu dem Transport von Gütern aufgefasst, wie man an solchen Redewendungen wie ›Man kann seinen Worten entnehmen, dass…‹, ›In diesem Buch steht …‹ oder ›Die Fernsehsendung hat den Inhalt …‹ erkennen kann. Man spricht von der ›Conduit Metapher‹ der Kommunikation. Kennzeichnend für diese Auffassung sind folgende Punkte:
»(1) language functions like a conduit, transferring thoughts bodily from one person to another; (2) in writing and speaking, people insert their thoughts or feelings in the words; (3) words accomplish the transfer by containing the thoughts or feelings and conveying them to others; and (4) in listening or reading, people extract the thoughts and feelings once again from the words.« (Reddy 1979: 290)
Das Modell suggeriert, dass sich im Geist des Sprechers etwas befindet, was er mitteilen möchte. Er verpackt es in einen sprachlichen Ausdruck und benutzt seine Sprechorgane, um es auszudrücken. Ein Hörer nimmt es durch seine Ohren auf und packt den transportierten Inhalt aus der sprachlichen Hülle aus. Wenn das Einpacken und das Auspacken richtig vollzogen werden, kann der Hörer verstehen, was der Sprecher meinte. Der Kommunikationsprozess ist zu seinem Ende gekommen. Die Kommunikationsbedingungen, die von der Conduit-Metapher unterstellt und suggeriert werden, sind folgende (Johnson / Lakoff 1982: 9, zit. nach Fiehler 1990: 105):
»(1) The participants are equally competent speakers of the same dialect of the same language, and individual signification is insignificant. (2) Relevant to the subject matter and the context, the participants share
| (a) |
the same cultural assumptions, |
| (b) |
the same relevant knowledge of the world, |
| (c) |
the same relevant background assumptions about the context of the utterance, |
| (d) |
the same understanding of what the conversation is about, and |
| (e) |
the same relevant conceptual metaphors and folk theories.« |
Aber auch andere Metaphern leiten unsere Auffassung von Kommunikation (vgl. Krippendorff 1994). Mit der Conduit-Vorstellung eng verbunden ist die Vorstellung von einer durch Kommunikation verursachten Kausalität oder durch Kommunikation zu erreichenden Kontrolle. ›Deine Worte machen mich glücklich‹, ›Gewaltdarstellungen im Fernsehen erhöhen das Gewaltpotenzial bei Jugendlichem, ›Der Wetterbericht veranlasste mich, den Regenschirm zu Hause zu lassen‹ – all dies sind Redewendungen, mit denen wir gewisse Kausalitäten postulieren und qua Kommunikation eine Kontrolle über die Empfänger suggerieren. Damit steht eine andere alltägliche und auch wissenschaftliche Leitvorstellung im Zusammenhang. Wir gehen davon aus, dass sich durch Kommunikationen Gemeinsamkeiten herstellen lassen. Es werden eher die integrierenden als die desintegrierenden Funktionen oder Effekte von Kommunikation betont. Diese Tendenz verstärkte sich, als im 19. Jahrhundert mit dem enormen Aufschwung im Bereich der technischen Medien die Metapher von der Kommunikation als einem Kanal oder einem Fluss aufkam. Kommunikation muss kanalisiert, in die richtigen Bahnen gelenkt, vor Überbeanspruchung geschützt und in ihren Kapazitäten berechnet werden.
Es soll nun keinesfalls angedeutet werden, dass diese alltagstheoretischen Metaphern und Konzepte in einem trivialen Sinne falsch sind. Ist es nicht vielmehr so, dass wir uns in unseren Kommunikationen an unseren Leitvorstellungen orientieren und wir damit unsere eigene Wirklichkeit erzeugen? Ist es nicht so, dass wir, wenn wir Kommunikation etwa als kausal wirkendes Kontrollorgan begreifen, uns entsprechend verhalten, dies auch von unseren Kommunikationspartnern verlangen und somit in einer Art Selffulfilling Prophecy unseren Konzepten zur ihrer Realität verhelfen? Andererseits kann man nicht erwarten, dass unsere alltagsweltlichen Vorstellungen dem sozialen Phänomen der Kommunikation gerecht werden. Aber dies gilt auch für die in der Wissenschaft diskutierten Konzeptionen. Sie sind ebenfalls Metaphern und Leitbilder, die manche Perspektive auf die Gegenstands- oder Erfahrungsebene freigeben, andere wiederum versperren. Von daher ist es die stete Aufgabe der Soziologie, ihr analytisches Begriffsschema zu überprüfen und sich die Annahmen, die in dieses Schema einfließen, zu vergegenwärtigen.
Читать дальше