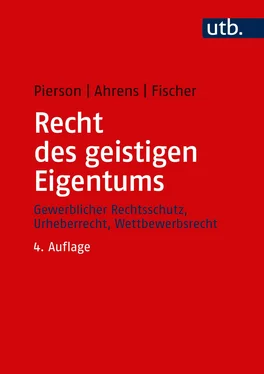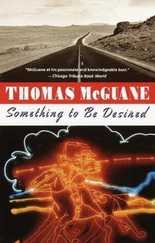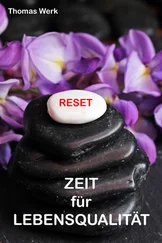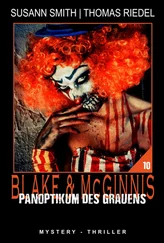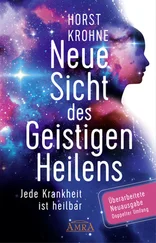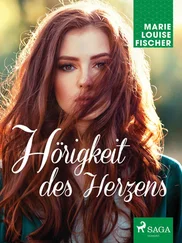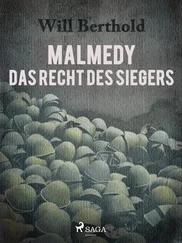Thomas Ahrens - Recht des geistigen Eigentums
Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Ahrens - Recht des geistigen Eigentums» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Recht des geistigen Eigentums
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Recht des geistigen Eigentums: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Recht des geistigen Eigentums»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der Band widmet sich wissenschaftlich fundiert den Grundlagen des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts.
Ein gesondertes Kapitel beschäftigt sich mit der Frage der Rechtsdurchsetzung.
Mit dieser Neuauflage auf aktuellstem Stand sind Studierende bestens für Studium und Prüfung gewappnet.
Recht des geistigen Eigentums — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Recht des geistigen Eigentums», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
1. Materielle Schutzvoraussetzungen
a) Kategoriale Anknüpfungkategoriale Anknüpfung
Der durch das Patentrechtgewährte Schutz knüpft an das Vorliegen einer Erfindung an, bei der es sich, wie dargestellt (s.o. III. 1.), ihrem Wesen nach um eine technische Problemlösung, eine „LehreLehretechnisches Handeln zum technischen Handeln“ handelt. Bei einem Sachpatent betreffend eine erfinderische Maschine etwa (z.B. zum Recycling von geschreddertem metallischem Autoschrott) besteht die Lehre in dem Aufzeigen der erforderlichen Konstruktion (Anordnung von Schüttungen, Förderbändern, Tauchbädern, Schüttelsieben, Magneten etc.) und der Erläuterung deren Funktion zur Lösung des technischen Problems (Trennung und Sortierung der unterschiedlichen beim Fahrzeugbau eingesetzten und wieder verwertbaren Edelmetalle). Die Bereicherung der in der Maschine realisierten Erfindung für die Technik und damit für die Gesellschaft äußert sich offensichtlich nicht in der visuellen Wirkung der Maschine als Raumform auf die menschlichen Sinne, sondern ihrem Zweck entsprechend in ihrem Funktionieren, ihrer Tauglichkeit zur Lösung eines Problems unter Ausnutzung von Naturkräften (hier u.a. Schwerkraft, elektromagnetische Anziehung), die durch die erfinderische Konstruktion zum Einsatz gelangen. Der Schutz des Gesetzes wäre daher untauglich, würde dieser, anstatt am geistigen Gehalt der erfinderischen LehreLehre und deren Nutzungsmöglichkeiten, an die äußere Gestalt der Maschine als visuell wahrnehmbare, auf die menschlichen Sinne wirkende Erscheinung anknüpfen. Der Schutz der erfinderischen Idee wäre auf die Ausführung in einer konkreten Form beschränkt und abgesehen von dem auf diese Weise nicht zu erfassenden geistigen Gehalt von Verfahrens- und Verwendungserfindungen, leicht durch formale, rein äußerliche, den geistigen Gehalt unberührt lassende Änderungen zu unterlaufen.1 Anders hingegen das UrheberrechtUrheberrecht, das dem Wesen der Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, sich in ihrem Dasein und der damit verbundenen Möglichkeit eines „geistigen Genusses“ – der Wirkung des Werks auf die menschlichen Sinne – zu erschöpfen, gerade dadurch entspricht, dass es unmittelbar an das Werk und die von diesem ausgehende Wirkung auf die menschlichen Sinne anknüpft. Bei einem Werk der Literatur, Wissenschaft und Kunst ist eine von seiner sinnlichen Aufnahme unabhängige Benutzungsmöglichkeit seinem Wesen nach ausgeschlossen. Der Schutz der Werke bezieht sich folgerichtig nicht, wie der von Erfindungen, auf eine Nutzung durch Anwendung oder Gebrauch (vgl. § 9 PatG), sondern auf die Verwertung durch körperlichkörperlichWiedergabee oder unkörperliche Wiedergabe (vgl. § 15 Abs. 1 und Abs. 2 UrhG), durch die sich das Werk den menschlichen Sinnen mitteilt. Diese wesensmäßige Unterscheidung zwischen geistigen Gütern, die sich in ihrer bloßen Existenz und ihrer sinnlichen Wirkung erschöpfen einerseits, und solchen, die durch ihre technisch-funktionelle Wirkung gekennzeichnet sind andererseits, ist gleichermaßen für die kategoriale Abgrenzung der Designs im Sinne des Designgesetzesvon den erfinderischen Arbeitsgerätschaften und Gebrauchsgegenständen im Sinne des GebrauchsmusterGebrauchsmuster-gesetz gesetzesmaßgeblich.2
b) Bewertungsmaßstab
Auch die sondergesetzlichen Regelungen, in denen die jeweiligen Schutzvoraussetzungen bestimmt sind, stimmen mit dem Wesen der jeweiligen Schaffensergebnisse überein. Nur bei einer mit dem Wesen der jeweiligen Schaffenstätigkeit übereinstimmenden Regelung ist deren Tauglichkeit sichergestellt, den für die Gewährung des SchutzrechtSchutzrechts maßgeblichen Erfolg bzw. Wert geistigen Schaffens zu erfassen. So entspricht es dem Wesen der ErfindungErfindung als technischer Problemlösung und dem Zweck des Patentrechts, den Fortschritt auf dem Gebiet der Technik zu fördern (s.u. § 7 II. 1.), dass das Patentrecht für die Gewährung des Patentschutzes entscheidend auf das Patenterfordernis des Beruhens auf erfinderischer Tätigkeit (§§ 1 Abs. 1, 4 PatG, Art. 52 Abs. 1, 56 EPÜ) abstellt. Durch die damit vorausgesetzte sog. ErfindungshöheErfindung-shöhe wird an die erfinderische Problemlösung ein an objektiven Beurteilungskriterien – dem Stand der TechnikStand der Technik, dem Können eines DurchschnittsfachmannFachmannDurchschnitts-Durchschnittsfachmanns – orientierter qualitativer Maßstab angelegt.1 Umgekehrt entspricht es dem Wesen der vom Urheberrechterfassten, aus dem Geist des Urhebers hervorgebrachten ursprünglich-geistigen Schöpfungen, die sich in ihrer Wirkung auf die menschlichen Sinne erschöpfen, dass der UrheberrechtUrheberrecht-sschutzsschutz – anstatt eines nach objektiven Kriterien zu bemessenden Qualitätserfordernisses – als wichtigste Voraussetzung die IndividualitätIndividualität des Werkes voraussetzt. Auch insoweit wird die Bedeutung der zutreffenden kategorialen Erfassung des jeweiligen Schutzobjektes deutlich, denn bei einem mit dem Wesen nicht zu vereinbarenden Verständnis, etwa der Erfindung als bloßer sinnlich wahrnehmbarer Gestaltung (Maschine, Vorrichtung, Stoff etc.), wäre bereits der Ansatz, die Perspektive für eine ihrem Wesen gerecht werdende Beurteilung verfehlt: Das bloße Dasein einer verkörperten Problemlösung, die von ihr ausgehende visuelle, akustische oder sonstige Wirkung auf die menschlichen Sinne (z.B. das Erscheinungsbild einer Vorrichtung, das Geräusch einer Maschine, der Geruch eines Stoffs etc.) ist offenbar kein geeigneter Bezugspunkt, der eine Bewertung der von ihr ausgehenden Beförderung des technischen Fortschritts, d.h. ihres erfinderischen Abstandes zum Stand der Technik, zuließe. Ein entsprechender Zusammenhang zwischen dem Wesen des in Rede stehenden Schutzgegenstandes und den gesetzlich festgelegten materiellen Schutzvoraussetzungen lässt sich auch für das Kennzeichenrechtnachweisen. So ist maßgebliche Schutzvoraussetzungim Markenrecht, dass die Marke als Zeichen geeignetist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unterscheiden(§ 3 Markengesetz; Art. 3 MarkenRL; Art. 4 UMV; Art. 15 Abs. 2 TRIPS). Hiermit trägt das Gesetz in gebotener Weise dem Umstand Rechnung, dass bei der Marke keinSchutzgegenstand in Frage steht, an den – wie bei einer Erfindung – ein qualitativer Maßstab („Erfindungshöhe“) anzulegen wäre oder bei dem es – wie bei einem Werk im Sinne des Urheberrechts – auf die schöpferische Individualität („Werkhöhe“) ankäme.2
c) NeuheitNeuheit
Auch die Frage, ob die Gewährung eines SchutzrechtSchutzrechtNeuheits von einem Neuheitserfordernis abhängt, kann nur im Einklang mit dem Wesen des zu schützenden Ergebnisses geistigen Schaffens beantwortet werden. So ist bei Ergebnissen geistigen Schaffens, die sich ihrem Wesen nach als technische Problemlösungendarstellen, eine Beurteilung ihrer Neuheit, d.h. ihrer Nichtzugehörigkeit zum Stand der Technik (§§ 1 Abs. 1, 3 PatG; Art. 52 Abs. 1, 54 Abs. 1 EPÜ; §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1 S. 1 GebrMG) möglich und für die Schutzgewährung auch erheblich. Nur eine neue technische Lehre ist geeignet, den technischen Fortschritt zu befördern und die Belohnung durch die Gewährung eines umfassenden AusschließlichkeitsrechtsAusschließlichkeitsrecht zu rechtfertigen. Demgegenüber kommt es im Urheberrecht auf die Frage der Neuheit nicht an.1 Ausschlaggebend für den Schutz eines Werkes der Literatur, Wissenschaft und Kunst ist dessen Individualität, nicht dessen Neuheit.2 Dass ein Urheber nur etwas schaffen kann, was ihm nicht bekannt ist, für ihn also „neu“ ist, ergibt sich bereits aus dem Begriff der Schöpfung, ist diesem „inhärent“.3 Die Frage der Neuheit erlangt daher im Urheberrecht allenfalls dadurch Bedeutung, dass zwischen der Frage der Neuheit und der der Individualität eine gewisse Relation insofern besteht, als einer objektiv vorbekannten Gestaltung keine schöpferische Eigentümlichkeit zugebilligt werden kann.4
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Recht des geistigen Eigentums»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Recht des geistigen Eigentums» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Recht des geistigen Eigentums» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.