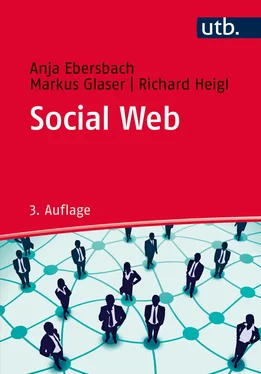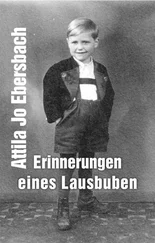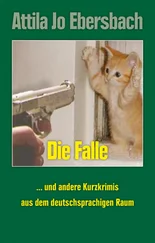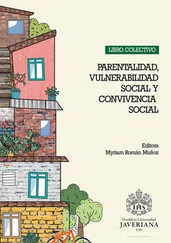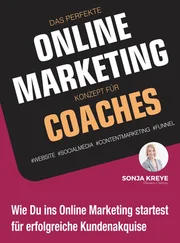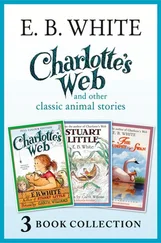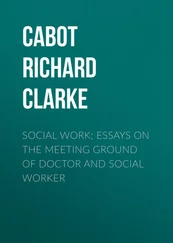Würde man das Buch heute komplett neu schreiben, gäbe es dennoch einige Akzentverschiebungen.
• Wenn das Social Web seine Möglichkeiten für eine offene Gesellschaft entfalten soll, ist der Blick stärker auf die Bedingungen einer kollaborativen Kultur zu richten, die immer noch aussteht. Die Formen der Zusammenarbeit und des Umgangs miteinander sind für das gemeinsame Erarbeiten und Verteilen von Wissen zentral und werden vielfach blockiert. Diesen Zusammenhang müssen wir besser verstehen lernen.
• Es wäre auch genauer nach den ökonomischen Bedingungen des Social Webs zu fragen. Gibt es so etwas wie eine Ökonomie des freien Wissens? Und wie würde sie aussehen? Wer hat Einfluss? Wer hat Zugriff? Die ökonomische Zukunft der digitalen Medien ist nicht nur ein Thema von Lobbyisten großer Player, sondern von Bedeutung für alle, die das Social Web als möglichst offenen medialen Raum erhalten wollen.
• Nach dem NSA-Schock steht das Thema Datenschutz und Bürgerrechte ganz oben auf der digitalen Agenda. Das Social Web und die privaten Daten sind dem Zugriff von Geheimdiensten und Konzernen maßgeblich ausgesetzt.
Wir werden diese Punkte vor allem im Ausblick ansprechen. Es sind Zukunftsfragen, die auch nicht in wenigen Jahren erledigt sind.
So liegt nun eine entsprechend aktualisierte Neuauflage vor. Wir möchten an dieser Stelle den Leserinnen und Lesern, aber auch den Rezensenten für ihr Feedback und ihre Unterstützung danken. Wir danken aber auch nicht zuletzt unserem Lektor Rüdiger Steiner bei der UVK Verlagsgesellschaft, der Geduld bewahrt und unser Buchprojekt zum Glück nicht aufgegeben hat.
| Regensburg, April 2016 |
Anja Ebersbach, Markus Glaser, Richard Heigl |
1 Einleitung
1.1 Perspektiven für eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Social Web
Worum geht es im Social Web? Eigentlich nicht um die Technik. Sie ist nur Bedingung. Im Mittelpunkt stehen die medial vermittelten Kooperationsformen, die kollektive Meinungsbildung und der kulturelle Austausch sozialer Gruppen. Das Verhalten im Netz ist eine spezifische Form sozialen Verhaltens mit Zusammenschlüssen und Abgrenzungen. Deshalb kann eine sinnvolle Analyse des Social Webs eigentlich nur sozialwissenschaftlich sein. Und dazu gehören natürlich auch die Ebenen des Kulturellen und des Politischen. Diese drei Ebenen müssen zusammengedacht werden. Schließlich ist das Social Web eng mit allen gesellschaftlichen Bereichen verzahnt: Es greift in die Arbeits- und Lebensweisen von Menschen ein, es gibt klare ökonomische Interessen, politische und rechtliche Implikationen, Auswirkungen auf die Erschließung von Inhalten für Bildung und Wissenschaft. Das Öffentliche und das Private, Fragen des Eigentums müssen neu bestimmt werden. Ganz generell erweitert das Social Web Horizonte der Nutzer und grenzt sie gleichzeitig wieder ein. Es ist ein Unterhaltungsmedium, das Spaß bereitet. Auf der privaten Ebene lernt man Menschen und Sichtweisen kennen, erlebt Erfolge und Enttäuschungen – auch Bedrohungen. Man erfährt sich als Teilhabender an einem Medium. Für Jugendliche, aber auch Ältere ist das Social Web längst Teil ihrer Sozialisation und Teil ihres kulturellen Austauschs.
Dies alles unterstreicht, dass man sich dem Thema nur interdisziplinär nähern kann. Die Politologin, der Medienwissenschaftler oder der Sozialpsychologe sind hier verloren, wenn sie sich nur in den engen Grenzen ihrer Disziplinen bewegen. Die unendliche Vielfalt der Beziehungen von Individuen über das Internet lässt sich aber nur wissenschaftlich ordnen, wenn man eine konkrete, sinnvolle Fragestellung an den zu untersuchenden Gegenstand hat.
Wir wollen in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass die moderne Wissenschaft im Zeitalter der Aufklärung mit dem Programm antrat, den Menschen als gesellschaftliches Wesen zum selbstkritischen Subjekt seiner Geschichte zu machen. Mit diesem Auftrag in der Tasche will sie auf das Bewusstsein der Menschen wirken und ihnen ihre emanzipatorischen Perspektiven aufzeigen. Das heißt konkret: Wie können Menschen über das Web ihre gesellschaftlichen Verhältnisse, ihre soziale Lage verändern oder auch nur besser erkennen? Was tun sie, bewusst oder unbewusst? Wo liegen Potenziale, wo Lernblockaden?
Das ist ein anderes Programm als das einer rein anwendungsorientierten Wissenschaft. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Medien wie dem Social Web kann und muss mehr sein als der Erwerb eines weiteren Passierscheins auf dem persönlichen Karriereweg, möglicherweise in ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Communitys aufzubauen, um diese oder die gewonnenen privaten Profile zu vermarkten.
Eine in unserem Sinne gefasste Wissenschaft der Medien ist praxisorientiert, nicht nur, weil eine mediale Praxis ihren Gegenstand bildet, sondern weil sie diese Praxis analysiert und Theorien darüber ausarbeitet, die auf diese Praxis zurückwirken und sie verändern. Dies ist schon deshalb dringlich, weil der Umgang und die notwendigen Kulturtechniken für das Social Web erst noch von allen Beteiligten zu erlernen sind.
Das sind hochgesteckte Ziele für ein Themengebiet, für das wir eine erste Einführung mit Lehrbuchcharakter vorlegen. Entsprechend können wir vieles nur andeuten. Und es ist uns bewusst, dass dieser Versuch, das Social Web etwas systematischer zu erfassen, oft Wirklichkeitsebenen auseinanderreißt, die eigentlich zusammengehören. Aber sollte es Sie zum Weiterdenken und Weiterarbeiten anregen – und sei es nur aus Widerspruch –, so haben wir unser Ziel erreicht.
Eine Wissenschaft der Medien kann eine spannende, fundierte, aber auch notwendig kontroverse Auseinandersetzung mit dem Gesellschaftlichen, dem »Sozialen«, in Gang setzen. Dazu muss sie ihren passiven Beobachterstandpunkt verlassen. Frei nach Brecht: Man kann die Welt nur erkennen, wenn man sie verändert.
1.2 Geschichte des Internets als sozialer Treffpunkt
Ab wann kann man eigentlich von einem »Social Web« sprechen? Die Begriffe »Social Software« und »Social Web« selbst gibt es erst seit vergleichsweise wenigen Jahren, aber die Entwicklung des Social Webs reicht bis in die Anfänge des Internets zurück.
Neue Perspektiven in der Internetgeschichte. Seit ein paar Jahren rücken die politischen Aspekte der Netzentwicklung in den Vordergrund. Wurde uns bislang die Geschichte des Internets oft nur als Geschichte technischer Entwicklungen und ihrer Erfinder präsentiert, so arbeitet beispielsweise Grasmuck (2002) in seiner Geschichte der freien Software den Kampf um Ordnungsmodelle und öffentliches Eigentum heraus. Der deutsche Wikipedia-Artikel zur Geschichte des Internets stellt den Konflikt zwischen basisorientierten Entwicklern und zentralistischen Tendenzen durch staatliche Kontrollorgane und Medienkonzerne dar (Wikipedia 2015) 1.
Umkämpfter sozialer Raum. Die beiden genannten Artikel sind erste Versuche, die Entwicklung des Internets in seinen historisch-gesellschaftlichen Kontext zu stellen und das Netz als umkämpften sozialen Raum zu begreifen. Die wissenschaftliche Forschung steht hier aber immer noch völlig am Anfang. Die Hervorhebung bisher unberücksichtigter Akteure und ihrer Intentionen ist dabei immer in Gefahr, alte Mythen durch neue Mythen zu ersetzen. Die 1970er-Jahre gelten beispielsweise als »wilde Phase« mit einer »Tauschökonomie für Software und Information«, einer »graswurzelbasierten Selbstorganisation«, »emergierende[n] Communities« und einem »Hacker-Geist, der jede Schließung, jede Beschränkung des Zugangs und des freien Informationsflusses zu umgehen weiß« (vgl. Grasmuck 2002: 180). Dieser Idealzustand wurde dann, folgt man dem eben genannten Wikipedia-Artikel, durch staatliche Eingriffe und vor allem durch die Kommerzialisierung des Internets in den 1990er-Jahren zerstört.
Читать дальше