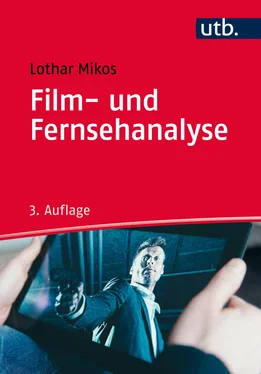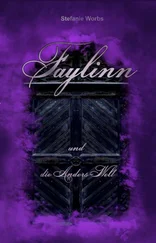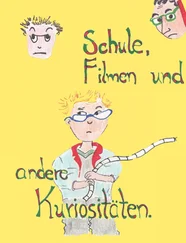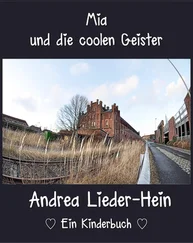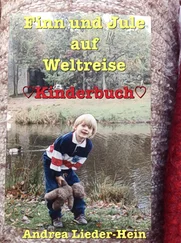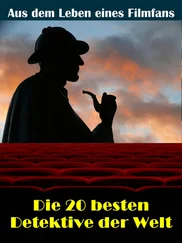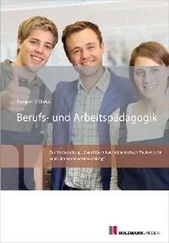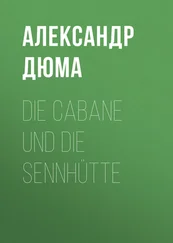1 ...6 7 8 10 11 12 ...21 Gegenstand der Film- und Fernsehanalyse müssen die textuellen Strategien sein, mit denen die kognitiven Aktivitäten der Zuschauer den Film im Kopf entstehen lassen. Ebenfalls analysiert werden müssen die Textstrategien, die die sozial-kommunikative Aneignung der Filme und Fernsehsendungen vorstrukturieren. Man kann sagen, dass über die sozial-kommunikativen Aktivitäten der Zuschauer die Filme aus dem Kopf wieder heraustreten und zu einem Bestandteil des sozialen Lebens werden, indem sie sich in die soziale Zirkulation von Bedeutungen in den gesellschaftlichen Diskursen einklinken.
1.2 Film- und Fernseherleben
Filme und Fernsehsendungen stellen für Zuschauer auch ein Erlebnispotenzial dar. Sie werden aus Vergnügen angeschaut, weil man lachen oder auch weinen kann. Möglicherweise werden sie aber auch angeschaut, weil ihre Inhalte sich gerade mit spezifischen Lebensthemen der Zuschauer verbinden. Erlebnisse sind für den einzelnen Zuschauer im Kino- oder Fernsehsessel nur möglich, wenn sich der Film oder die Fernsehsendung in seine subjektiven Sinnhorizonte einfügt. Norbert Neumann und Hans J. Wulff haben auf diese »Zwischenstellung des Erlebnisses« hingewiesen:
»Nun ist gerade die Zwischenstellung des Erlebnisses zwischen den Strukturen des Textes und den aus ihm stimulierten Bedeutungsproduktionen des Subjekts eine methodisch außerordentlich widerspenstige Tatsache. Das Erlebnis ist erst in der Erinnerung abgeschlossen, ist selbst aber eine offene geistige Tätigkeit. Das Erleben ist ein Prozess, eine aktualgenetische Austausch- und Wechselbeziehung zwischen Subjekt und Text. Erleben ist Übersetzen, weil das Bedeutungsangebot des Textes vermittelt werden muss mit den Sinnhorizonten des Erlebenden« (Neumann/Wulff 1999, S. 4).
Im Film- und Fernseherleben vermischt sich das Soziale mit dem Subjektiven, denn sowohl die Texte als auch die Zuschauer sind in soziale und kulturelle Kontexte eingebunden. Das zeigt sich u.a. schon an der Abhängigkeit des Erlebnisses von der Rezeptionssituation: Während man sich im dunklen Kinosaal selbstvergessen dem Geschehen auf der Leinwand widmen und gegebenenfalls den kommunikativen Kontakt zu den Begleitern suchen kann, findet das Fernsehen im häuslichen Ambiente statt, wo zahlreiche Varianten von Störfaktoren bestehen können, die nicht vom Fernsehenden beeinflussbar sind, aber die involvierte, konzentrierte Hinwendung zum Bildschirm behindern – einmal abgesehen davon, dass die Aktivität »Fernsehen« häufig von anderen Tätigkeiten begleitet werden kann. Allerdings hängt das Erlebnis nicht nur von der Intensität der Zuwendung und dem Involvement ab, sondern vor allem von der Verbindung mit den subjektiven Sinnhorizonten. Es findet seinen Ausdruck im Subjekt: »Manchmal aber erfasst der Prozess des Erlebens die ganze Person, vermag Tiefenschichten der Erfahrung, des Wünschens oder der Moral zu aktivieren« (ebd., S. 5). Der Zuschauer ist bewegt oder gerührt, und die Zuschauerin kann sich vor Lachen kaum noch halten (vgl. Mikos 2011). In diesem Sinn sind Film- und Fernsehtexte nicht nur zum Wissen und zur sozialen Kommunikation der Zuschauer hin geöffnet, sondern auch zu den Emotionen und Affekten sowie zum praktischen Sinn.
Emotionen und Affekte spielen für das Film- und Fernseherleben eine entscheidende Rolle. »Das Kino ist seit jeher ein privilegierter Ort für Emotionen, und wer über Film und Filmerleben redet, schließt dabei im Grunde stets die emotiven Wirkungen ein, denn sie gehören essenziell dazu« (Wuss 2002, S. 123). Zuschauer gehen schließlich ins Kino, »um sich den Emotionen auszusetzen« (Wulff 2002, S. 109). Das stellte auch schon Hugo Münsterberg im Jahr 1916 in seiner psychologischen Studie »Das Lichtspiel« fest. Dort heißt es: »Die Darstellung von Emotionen muß das Hauptanliegen des Lichtspiels sein« (Münsterberg 1996, S. 65). Emotionen und Affekte treten jedoch in Verbindung mit kognitiven Aktivitäten der Zuschauer auf, denn eine Szene muss verstanden und mit Bedeutung gefüllt werden, bevor die Zuschauenden affektiv berührt sein und Emotionen entwickeln können. Genauso müssen sie die Gefühle der Figuren verstehen können, bevor sie möglicherweise in einem Akt der Empathie mitfühlen. Emotionen sind ohne Kognitionen nicht denkbar. In der Psychologie wird in der Regel zwischen Affekt, Emotion und Mood unterschieden (vgl. dazu Kaczmarek 2000, S. 260). Während Emotionen als innere mentale Zustände gesehen werden, sind Affekte auf ein Objekt gerichtet und »Aspekte der Ereignisbewertungen durch das Subjekt« (ebd., S. 261). Unter Mood (Stimmung) wird ein diffuser Zustand eines Subjekts verstanden, der bestimmte emotionale Bewertungen wahrscheinlicher erscheinen lässt als andere. Wenn ein Zuschauer in einer diffusen Stimmung der Unlust ist, wird es wahrscheinlicher, dass er verschiedene Fernsehsendungen, durch die er gerade zappt, kritisiert, als dass er sich beispielsweise für eine neue Gameshow vollauf begeistern könnte. Wenn sie jedoch in einer diffusen Stimmung freudiger Erwartung ist, wird sie wahrscheinlich auch noch dem langweiligsten Gespräch in einer Talkshow etwas abgewinnen können und eben nicht entnervt den Fernseher ausschalten.
Um Filme und Fernsehsendungen in ihrem kommunikativen Verhältnis zu den Zuschauern zu analysieren, muss nicht im obigen Sinn zwischen Affekt, Emotion und Mood unterschieden werden. Stattdessen reicht es meines Erachtens aus, zwei grundlegende Arten von Emotionen zu unterscheiden (vgl. Mikos 2001a, S. 110 ff.): sogenannte Erwartungsaffekte, die in einem engen Zusammenhang mit Kognitionen stehen, und Emotionen als situative Erlebnisqualität und sinnliche Erfahrung, die auf früheren, lebensgeschichtlich bedeutsamen Erfahrungen der Zuschauer beruhen. Dies geht weiter als die rein psychologischen Bestimmungen, da Emotionen hier nicht als isolierte, intraindividuelle Erregungsstufen, sondern in Beziehung zur sozialen Realität der Rezipienten gesehen werden. Denn Emotionen können nur im situativen Rahmen sozialer Interaktionen auftauchen. Sie sind ebenso wie die Kognitionen notwendiger Bestandteil der Interpretation von Situationen; ohne sie kann das Subjekt nicht handeln. Die »je aktuellen Gefühle sind ein relevanter und unverzichtbarer Teil dafür, daß der Mensch aktiv handelt und erlebt, wie er es tut, also ein inhärenter Bestandteil seiner Interpretation« (Krotz 1993, S. 112). Das wird auch in Bezug zur Film- und Fernsehrezeption deutlich. So hat Ed S. Tan (1996, S. 195 ff.) ein Modell des Emotionsprozesses in Bezug auf die Spielfilmrezeption vorgelegt. Er geht davon aus, dass die narrative Struktur eines Filmtextes ein Situationsmodell aufbaut, in dem eine emotionale Bedeutungsstruktur aufgehoben ist, und erst dadurch kommt es zu einer emotionalen Reaktion bzw. Antwort. Das ist nur möglich, weil Handlungssituationen – ob im Film oder im Alltag – grundsätzlich eine emotionale Bedeutungsstruktur aufweisen. Deutlich wird so, dass die Emotionen nicht nur von Figuren und Charakteren im Film oder der Fernsehsendung angeregt werden (vgl. Smith 1995), sondern auch von dramatischen Konflikten, die z.B. zu einer emotionalen Anspannung der Zuschauer führen können (vgl. Wuss 1999, S. 318 f.), sowie von den Interaktionsbeziehungen, die sich im »sozialen Kleinsystem« (Wulff) der Handlung eines Films ergeben. In diesem Sinn geht Hans J. Wulff (2002, S. 110) davon aus, dass sich z.B. Empathie nicht einfach auf einzelne Figuren richtet, sondern dass Spielfilme ein »empathisches Feld« aufbauen. Darunter versteht er imaginierte Szenarien, die als ein symbolischer Kontext »des sozialen Lebens, des Genres, der besonderen Handlung und des besonderen dramatischen Konflikts« (ebd.) gesehen werden, der sowohl in Geschichten als auch in Personenkonstellationen integriert ist. Figuren und Charaktere werden dann im Rahmen dieses symbolischen Kontextes wahrgenommen Die Filmwissenschaftlerin Margrethe Bruun Vaage unterscheidet daher zwischen dem »automatischen Nachvollzug des Gefühlszustands des Anderen anhand seiner Körperhaltung (körperbezogene Empathie)« und der imaginativen, bei der sich der Zuschauer »in seiner Vorstellung partiell in die Situation des Anderen versetzen und diese verstehen« kann (Bruun Vaage 2007, S. 101). Nur so kann sich Empathie entwickeln.
Читать дальше