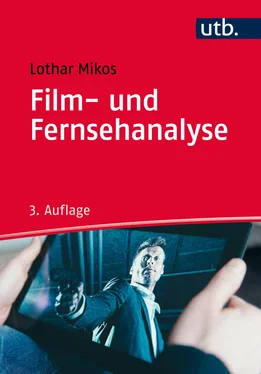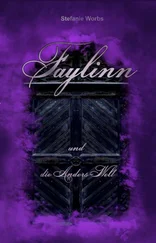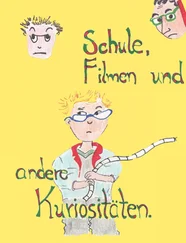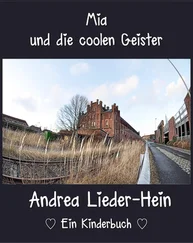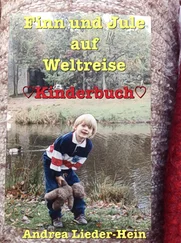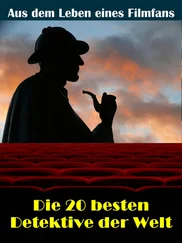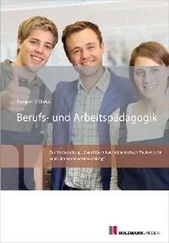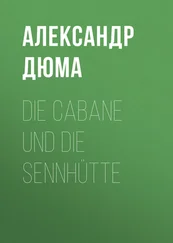– Gattungen und Genres
– Intertextualität und Transmedia Storytelling
– Diskurs
– Lebenswelten
– Produktion und Markt
Historische, juristische und gesellschaftliche Kontexte werden hier nur berücksichtigt, insofern sie einen der fünf genannten Kontexte beeinflussen. Diese Kontexte sind für die Analyse in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits spielen sie bei den bisher genannten Ebenen der Analyse (Inhalt und Repräsentation, Narration und Dramaturgie, Figuren und Akteure, Ästhetik und Gestaltung) eine wichtige Rolle, indem sie sich konkret auf die Film- und Fernsehtexte auswirken. Andererseits findet die Produktion von Bedeutung nicht unabhängig von ihnen statt.
Je nach Kontext können Zuschauer mit demselben Film oder derselben Fernsehsendung unterschiedliche Bedeutungen produzieren. Denn: »Kulturelle Texte sind immer kontextuell artikuliert, in unterschiedlichem Maße polysem strukturiert, haben widersprüchliche, instabile und bestreitbare Bedeutungen« (Winter 2001, S. 347). Je nach Genre sind Figuren und Akteure z.B. anders gestaltet, und die Narration korrespondiert auf je andere Weise mit der Ästhetik. So spielen – wie bereits erwähnt – Komödien meist in hellen Räumen, Horrorfilme dagegen sind in dunklen, unübersichtlichen Häusern lokalisiert. Polizisten spielen in Gangsterfilmen und Thrillern als Antagonisten der Gangster und Nebenfiguren eine andere Rolle als in Polizeifilmen, in denen sie die Protagonisten und Helden sind. Je nach den Diskursen, die zu einer bestimmten Zeit in einer Gesellschaft zirkulieren, fällt die Produktion von Bedeutung bei einzelnen Filmen und Fernsehsendungen unterschiedlich aus. Tony Bennett und Janet Woollacott (1987, S. 64 f.) haben den Begriff »reading formations« geprägt, mit dem sie ausdrücken, dass Texte zu unterschiedlichen Zeiten abhängig von sozialen und kulturellen Entwicklungen auch unterschiedlich gelesen werden. Filme greifen auch zeitbedingte gesellschaftliche Diskurse auf, die sie bereits in einer bestimmten Epoche verorten, in der sie sich auch für die Zuschauer ganz wesentlich in die Zirkulation von Bedeutung einfügen. Während z.B. die Science-Fiction-Filme der 1950er und 1960er Jahre sich in den Diskurs des Kalten Krieges einfügten, ist die »Star Trek«-Serie in Film und Fernsehen eher in einem Diskurs des technologischen Aufbruchs und der multikulturellen Gesellschaft verortet. Auch James Bond hatte zu Zeiten des Kalten Krieges andere Aufgaben als in den 1980er Jahren (vgl. Bennett/Woollacott 1987). Im Folgenden werden die fünf für die Analyse relevanten Kontexte kurz in ihrer Bedeutung für die Film- und Fernsehtexte und deren Zuschauer geschildert, bevor dann in Kapitel 5in Teil IIdes Buches ausführlicher auf die damit verbundenen theoretischen Ansätze eingegangen wird.
Da narratives Wissen und das Wissen um die filmischen Darstellungsformen eine wichtige Rolle im Prozess des Filmverstehens und der Entwicklung der individuellen Geschichte im Kopf spielen, ist es wichtig, in der Analyse das Genre des zu analysierenden Films zu bestimmen und die Konventionen der Erzählung und der Darstellung herauszuarbeiten. Denn die Zugehörigkeit eines Films oder einer Fernsehsendung zu einem bestimmten Genre strukturiert bereits die Erwartungen des Publikums vor. Ein Genre ist in diesem Sinn gewissermaßen ein Gebrauchswertversprechen. Jeder wird von einer Gameshow die Darbietung von Spielen erwarten und nicht den Bericht über soziale Missstände in Großstädten. Niemand wird von einer Nachrichtensendung erwarten, dass dort ein Fantasy-Rollenspiel oder eine Hundedressur stattfinden, aber jeder wird von einem Western erwarten, dass dort galoppierende Pferde und schießende Männer zu sehen sind. Die Inszenierung von Figuren, Beziehungen, Handlungsräumen oder Interaktionsmustern hängt u.a. vom Genre ab. So wird z.B. Gewalt je nach Genre unterschiedlich inszeniert (vgl. Mikos 2001b). Unter dem Begriff »Genre« werden hier Muster und Konventionen der Erzählung bezeichnet, die als »Systeme von Orientierungen, Erwartungen und Konventionen, die zwischen Industrie, Text und Subjekt zirkulieren« (Neale 1981, S. 6), verstanden werden.
Ohne die Genrezuordnung und die Kenntnis der Genrekonventionen können Probleme beim Verständnis des Films oder der Fernsehsendung auftauchen. Die Geschichte im Kopf lässt sich nicht mehr so recht zusammenfügen. Wenn z.B. in einem Film zeitweise Gegenstände durch die Luft schwirren, weil die Gesetze der Schwerkraft nicht gelten, werden die Zuschauer eine andere Geschichte im Kopf bilden, wenn sie wissen, dass es sich um einen Science-Fiction-Film handelt, als wenn sie von einem Melodram ausgehen und die entsprechenden Szenen als symbolischen Ausdruck der Innenwelt der Protagonistin ansehen. Nur wer die Genrekonventionen des Western kennt, wird die komischen und zum Teil ironischen Elemente in einem Film wie »Erbarmungslos« verstehen können und an dem Spiel mit den Genrekonventionen und der damit verbundenen Thematisierung des Western-Mythos seine Freude haben (vgl. Monsees 1996, S. 61 ff.). Die Kenntnis des Genres und seiner Konventionen schafft eine Art kommunikatives Vertrauen, die Zuschauer können sich ihrer Erwartungen sicher sein. Zugleich kann der Text darauf vertrauen, dass die Zuschauer ihr Wissen aktivieren und so ihren Teil zur Geschichte beitragen. Das gilt auch für die Hollywood-Blockbuster zu Beginn des 21. Jahrhunderts, die verschiedene Genreelemente mischen, um ein möglichst großes Publikum zu erreichen (vgl. Mikos u.a. 2007, S. 19 ff.; Schweinitz 2006, S. 90 ff.; Thompson 2003). Wer nicht um die Genrekonventionen eines Films weiß, wird keine entsprechenden Erwartungen an den Film haben und demzufolge eine andere Geschichte im Kopf entwickeln als ein Zuschauer mit Genrekenntnissen.
Intertextualität spielt als Kontext eine wichtige Rolle. Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass mit Intertextualität die Beziehung eines Film- oder Fernsehtextes zu anderen Texten gemeint ist (vgl. Mikos 1999; Pearson 2014). Das können andere Film- und Fernsehtexte sein, aber auch andere mediale Texte wie ein Roman oder ein Gemälde. Intertextualität ist für die Film- und Fernsehanalyse vor allem dann wichtig, wenn die Bedeutung eines Film- oder Fernsehtextes über und durch die Referenzen zu anderen Texten produziert wird.
Jeder neue Film und jede neue Fernsehsendung tritt in ein bereits vorhandenes Universum von Texten ein, das alle bisher produzierten Filme und Fernsehsendungen umfasst. Das ist die produktionsästhetische Perspektive der Intertextualität. Jeder neue Film von Quentin Tarantino steht nicht nur im Kontext aller früheren Filme dieses Regisseurs, sondern auch im Kontext aller anderen amerikanischen Filme, aller europäischen Filme, aller Western usw. Jede neue Quizshow im Fernsehen steht im Kontext aller anderen Quizshows, aber auch im Kontext aller anderen Shows mit dem jeweiligen Moderator. Jeder Film- und Fernsehtext steht also in einer Vielzahl von kontextuellen Bezügen zu anderen Texten. Andererseits wird kein Text unabhängig von den Erfahrungen und Erlebnissen mit anderen Texten rezipiert (vgl. Eco 1987, S. 101), d.h., dass Filme und Fernsehsendungen immer in dem Kontext der Rezeption anderer Filme, Fernsehsendungen und weiterer Medien der Populärkultur gesehen werden. Das ist die rezeptionsästhetische Seite der Intertextualität. Jede neue Episode einer Krimireihe wie »Navy CIS«, »Criminal Minds« oder »Mord mit Aussicht« wird vor dem Hintergrund aller anderen Folgen dieser Reihe sowie vor dem Hintergrund aller anderen Kriminalserien betrachtet, die der jeweilige Zuschauer in seinem bisherigen Leben rezipiert hat. Jede romantische Komödie mit Sandra Bullock in der Hauptrolle wird vor dem Hintergrund aller Filme mit dieser Schauspielerin, aller romantischen Komödien, aber z.B. auch aller Melodramen, die der jeweilige Zuschauer bisher gesehen hat, angeschaut.
Читать дальше