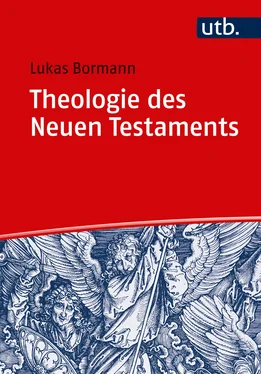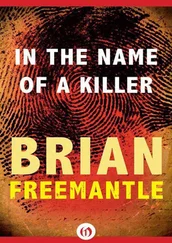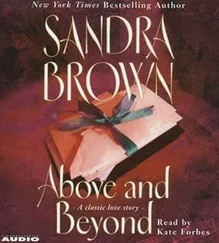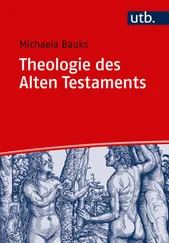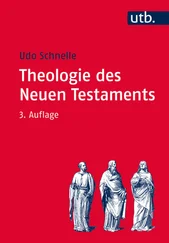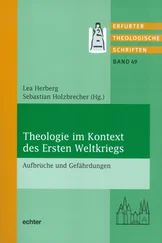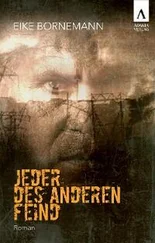1 ...8 9 10 12 13 14 ...21 Die quellensprachliche Bezeichnung gr. Ioudaios (Ἰουδαῖος) für „Jude“ hat eine starke ethnisch-geographische Komponente und bezeichnet Personen, die sich nach Herkunft, Lebensweise, Kult, Rechts- und Gemeinschaftsvorstellungen auf die Bevölkerung der Landschaft Judäa zurückführen. 3Aus diesem Grund wird für eine deutsche Übersetzung alternativ zu Jude/Jüdin, eine Bezeichnung, die die religiöse Komponente und damit die selbstgewählte Lebensweise hervorhebt, auch von Judäer/Judäerin gesprochen. Der letztgenannte Begriff will verdeutlichen, dass die Juden als Judäer unter ethnischen und politischen Gesichtspunkten ein Volk sind wie Ägypter, Griechen und Römer, während die Bezeichnung „Jude“ die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft hervorhebt und damit die Vorstellung von einer selbstgewählten Lebensweise in den Mittelpunkt stellt.
In der Forschung ist die Frage umstritten, inwiefern und ab wann mit „Jude“ eine selbstgewählte Lebensweise bezeichnet wird. Cohen sieht ein solches Auseinandertreten der ethnischen und der religiösen Komponenten in Folge der Makkabäeraufstände nach 167 v. Chr. 4Ab diesem Zeitpunkt ist man nicht mehr einfach nur Jude aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, sondern aufgrund der Wahl einer Lebensweise, die sich am religiös-ethnischen Gesetz, das auch als väterliche Überlieferungen (gr. patrioi nomoi; πατρίοι νόμοι) bezeichnet wird, orientiert. Mit diesem Zurücktreten der ethnischen Komponente setzt zudem eine Diversifizierung des Judentums ein. In dieser Zeit kommt der Begriff Ioudaismos auf (gr. Ἰουδαϊσμός). Im zweiten Makkabäerbuch wird von der Selbstbehauptung einer später dominanten Gruppe von Judäern, den Makkabäern, berichtet, die mit Ioudaismos das selbst gewählte aktive Eintreten für die Anliegen des Judentums bis hin zum Aufstand oder zum Martyrium bezeichneten:
2Makk 2,21: (Bericht über …) die Erscheinungen, die vom Himmel her zugunsten derjenigen geschahen, die tapfer und ehrbar für das Anliegen des Judentums (Ioudaismos) eintraten, damit sie, obwohl sie nur wenige waren, in die Lage versetzt würden, das ganze Land zur Beute zu machen und die Menge der Barbaren (Nichtjuden) zu verfolgen.
2Makk 8,1: Judas aber, der auch Makkabäer (hieß), und diejenigen, die mit ihm verborgen in die Dörfer eingedrungen waren, riefen ihre Verwandten und, nachdem sie diejenigen, die auf das Anliegen des Judentums (Ioudaismos) bedacht waren, hinzugenommen hatten, brachten bis zu 6000 (Männer) zusammen.
2Makk 14,37 f.: Razis aber, einer der Jerusalemer Ältesten […] auch „Vater der Juden“ genannt, wurde bei Nikanor (ein Vertrauter des seleukidischen und damit nichtjüdischen Königs Antiochos IV.) angezeigt, denn er war in den vorherigen Zeiten der Verfolgung wegen des Anliegens des Judentums (Ioudaismos) vor Gericht gezogen worden, und hatte Leib und Seele für das Anliegen des Judentums (Ioudaismos) mit voller Entschiedenheit eingesetzt.
Ioudaismos, hier mit „Anliegen des Judentums“ übersetzt, bezeichnet das bewusste und aktive Eintreten für ein bestimmtes Verständnis von Judentum, das sich von den Lebensweisen, die sich an der hellenistischen Weltkultur orientieren, abgrenzt. In Auseinandersetzung mit Kultur, Recht und Religion des Hellenismus und vor allem mit einem hellenisierenden Judentum betont der Ioudaismos die Ausdrucksformen des Judentums, die die unverwechselbaren Besonderheiten hervorheben und die als Festhalten an den väterlichen Überlieferungen, der Tora, verstanden werden. 5Das sind vornehmlich Beschneidung, Sabbatgebot, Speisegesetze, Ehegesetze und Monolatrie.
Diese bewusste Form der aktiven Lebensgestaltung des Judentums als Ioudaismos in Abgrenzung von anderen Lebensformen erwähnt auch Paulus, um seine Lebensführung vor seiner Berufung zum Apostel der (nichtjüdischen) Völker zu beschreiben:
Gal 1,13 f.: Ihr habt von meiner Lebensführung einst gemäß des Anliegens des Judentums (Ioudaismos) gehört, wie ich im Übermaß die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu vernichten suchte, (14) und (wie ich) in der Wahrnehmung dieses Anliegens des Judentums (Ioudaismos) viele Altersgenossen in meiner Generation übertraf – ich war in hervorragender Weise ein Eiferer für die väterlichen Überlieferungen.
Es bilden sich somit etwa ab dem 2. Jh. v. Chr. innerhalb des antiken Judentums verschiedene Praktiken, dem jüdischen Gesetz zu folgen, aus. Damit ist die Entstehung von Gruppierungen wie den Pharisäern, Sadduzäern oder Essenern verbunden, die sich durch je eigene Interpretationen und Handhabungen des jüdischen Gesetzes voneinander unterscheiden, sich aber zugleich als Teil des Judentums verstehen. Der Jerusalemer Tempel bleibt bis zu seiner Zerstörung ein wichtiges, vergleichsweise niederschwelliges Bindeglied für diese verschiedenen Gruppierungen. Unter diesen gibt es allerdings auch einige, die sich vom Jerusalemer Tempelkult abwenden, wie etwa die Samaritaner und die „Gemeinschaft“ (hebr. yahad; יחד), die für die Gruppe der gemeinschaftsbezogenen Qumrantexte verantwortlich ist. 6
Das Wort Ioudaios wird in der Antike von Nichtjuden als Fremdbezeichnung mit Betonung der ethnischen Zugehörigkeit zum jüdischen Volk verwendet. Als Selbstbezeichnung der Juden dient es vor allem zur Unterscheidung von anderen Völkern, wobei sowohl die religiöse wie die ethnische Komponente im Blick sind. Diese Funktionen erfüllt auch der Begriff „Hebräer“ (gr. Hebraios; Ἑβραῖος). Als Selbstbezeichnung eigener Art mit einer starken religiösen Komponente wird auch der Begriff „Israel“ verwendet. Mit „Israel“ bezeichnet das antike Judentum sich selbst als die unverwechselbare besondere Gemeinschaft im Gegenüber zu dem einen Gott, der als Namen das Tetragramm, JHWH, trägt. Diese Selbstbezeichnung spiegelt eher eine Binnenperspektive wider und enthält neben der religiösen auch eine normative Komponente.
Das Judentum der Antike reflektiert sich selbst als eine religiös-ethnische Gruppierung, die immer wieder zur Selbstbehauptung gegenüber ihrer Umwelt herausgefordert ist. Diese Situation bringt auch innere Konkurrenzen, um die Frage hervor, wie sich das Judentum selbst versteht und in welchen Praktiken und Überzeugungen es am besten repräsentiert ist. Die variierenden und schillernden Selbst- und Fremdbezeichnungen wie Jude, Hebräer und Israelit spiegeln diese Situation ebenso wider, wie der Begriff Ioudaismos, der das aktive Eintreten für die Anliegen des Judentums bezeichnet.
2.3Gott
In der Antike ist die Vorstellung, dass Götter existieren und das Geschick der Menschen beeinflussen können, weit verbreitet. In Homers Ilias, dem eminenten Grundtext antiker Bildung, greifen die Götter unmittelbar in das weltliche Geschehen ein und beteiligen sich auf beiden Seiten an den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Trojanern und Griechen. Atheismus im Sinne der kognitiven Überzeugung, dass keine Götter existierten, ist außerordentlich selten und setzt im Grunde die spezifischen Bedingungen der europäischen Geistesentwicklung ab dem 16. Jh. voraus. Unter gr. a-theos (ἄθεος), „gottlos“, oder a-sebes (ἀσεβής), „unfromm“, versteht man in der Antike vielmehr jemanden, der sich der öffentlichen und gemeinschaftlichen kultischen Religionsausübung verweigert und deswegen als religiöser Frevler und zugleich als moralisch Asozialer gilt. Philo von Alexandrien erläutert das Wort atheos aus jüdischer Perspektive mit einem polemischen Akzent, indem er festhält, dass derjenige, der keine Götter verehrt, und derjenige, der viele Götter verehrt, in gleicher Weise in die Irre gehen (migr. Abr. 69). In den Psalmen ist der „Gottlose“ oder „Frevler“ ein Mensch, der die göttlichen Gebote missachtet und damit zum Ausdruck bringt, dass er keine Strafe durch Gott fürchtet. Ein solcher Mensch ist verloren, vergänglich, „wie Spreu, die der Wind verweht“ (Ps 1,4). Ihm gegenüber steht der „Fromme“ (gr. hosios; ὅσιος, z. B. Ps 4,4), der in seiner Verehrung Gottes auch die Befolgung des göttlichen Gesetzes miteinbezieht und somit auch ein „Gerechter“ (gr. dikaios; δίκαιος, z. B. Ps 1,6) ist. Diese Verschränkung des Gerechten mit dem Frommen, die die griechische Übersetzung der Bibel, die Septuaginta (lat. für siebzig), vertritt, entspricht dem griechisch-hellenistischen Tugendideal, nach dem der Mensch „fromm“ gegenüber Gott und den Göttern sein soll und zugleich „gerecht“ gegenüber seinen Mitmenschen. Bereits Platon (428–348 v. Chr.) spricht vom Ideal einer „frommen und gerechten“ Lebensführung. 7
Читать дальше