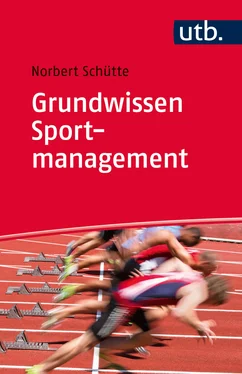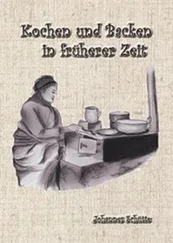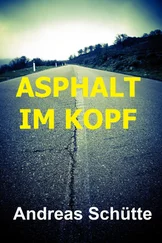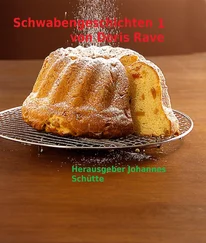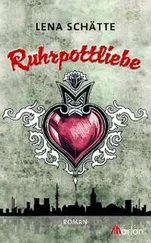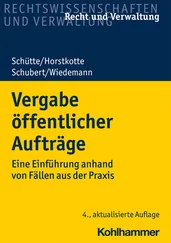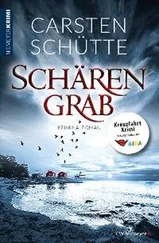Geschichte des Sportmanagements
| 2.1 |
Ausdifferenzierung des Sportmanagers |
| 2.2 |
Geschichte des Fachs Sportmanagement |
| 3 |
Allgemeine Prinzipien des Sportmanagements … |
| 3.1 |
Ziele oder „Ohne Ziele kein Management“ |
| 3.2 |
Arbeitsteilung |
| 3.2.1 |
Taylorismus oder „the one best way“ |
| 3.2.2 |
Fordismus oder „solange es schwarz ist“ |
| 3.2.3 |
Probleme der Arbeitsteilung |
| 3.2.4 |
Postfordismus oder die individualisierte Masse |
| 3.2.5 |
Fazit |
| 3.3 |
Bürokratie oder „Regeln statt Willkür“ |
| 3.3.1 |
Bürokratie und erwerbswirtschaftliche Betriebe |
| 3.3.2 |
Bürokratie und Sportverwaltung |
| 3.3.3 |
Bürokratie und Non-Profit-Organisationen |
| 3.4 |
Kontingenztheorie oder die Abhängigkeit von der Umwelt |
| 3.4.1 |
Externe Umwelt |
| 3.4.2 |
Interne Umwelt |
| 3.4.3 |
Grenzen des Ansatzes |
| 3.5 |
Finanzierung oder „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ |
| 3.5.1 |
Erwerbswirtschaftliche Betriebe |
| 3.5.2 |
Sportverwaltung |
| 3.5.3 |
Vereine und Verbände |
| 3.6 |
Wissen |
| 3.6.1 |
Datum – Information – Wissen |
| 3.6.2 |
Instrumente |
| 3.6.3 |
Grenzen des Ansatzes |
| 3.7 |
Die Kunst der Planung und der Kontrolle |
| 3.8 |
Entscheidungen |
| 3.8.1 |
Der rationale Entscheider |
| 3.8.2 |
Grenzen des rationalen Entscheidens |
| 3.8.3 |
Das Mülleimer-Modell des Entscheidens |
| 3.8.4 |
Langlebigkeit des Mythos der rationalen Entscheidung |
| 3.9 |
Durchführung und Führung von Menschen |
| 3.9.1 |
Hawthorne-Experimente oder die Entdeckung des human factors |
| 3.9.2 |
Hawthorne-Experimente oder formale vs. informale Struktur |
| 3.9.3 |
Zwischenfazit |
| 3.9.4 |
Konfliktsoziologische Perspektive |
| 3.9.5 |
Führung durch Motivierung |
| 3.9.6 |
Führung mit dem Grid Management |
| 3.9.7 |
Führung durch Techniken: MbO |
| 3.9.8 |
Heroen und Charisma |
| 3.9.9 |
Institutionenökonomischer Ansatz oder die verdeckten Kosten |
| 3.9.10 |
Governance |
| 3.10 |
Strategie |
| 3.10.1 |
Erwerbswirtschaftliche Betriebe |
| 3.10.2 |
Sportverwaltung |
| 3.10.3 |
Vereine und Verbände |
| 3.10.4 |
Grenzen des Ansatzes |
| 3.11 |
Organisation und Wandel: Das Implementierungsproblem und sein Management |
| 3.11.1 |
Wandel und die kontingenztheoretische Schule |
| 3.11.2 |
Organisationsökologie |
| 3.11.3 |
Der neue Institutionalismus in der Organisationstheorie |
| 3.11.4 |
Hage und Aiken – ein Phasenmodell |
| 3.11.5 |
Rogers – Diffusion of Innovation |
| 3.11.6 |
Rezeptive vs. nicht-rezeptive Kontexte |
| 3.11.7 |
Implementierungsmanagement nach Kotter |
| 3.11.8 |
Organisationsentwicklung |
| 3.11.9 |
Lernende Organisation |
| 3.12 |
Wirtschaftsethik |
| 4 |
Besonderheiten des Sportmanagements |
| 4.1 |
Besondere Bedeutung der NPO im Sport |
| 4.2 |
Nutzen- vor Profitmaximierung in Europa |
| 4.3 |
Kooperenz |
| 4.4 |
Regulierung der Liga |
| 4.4.1 |
Keine Tendenz zur Ausgeglichenheit |
| 4.4.2 |
Salary Cap |
| 4.4.3 |
Draft-System |
| 4.4.4 |
Financial Fairplay |
| 4.5 |
Produktbesonderheiten |
| 4.6 |
Vorherrschaft der Dienstleistung |
| 4.7 |
Besonderheit der Gütertypen |
| 4.8 |
Fazit |
| 5 |
Spezielle Ansätze |
| 5.1 |
Organisationskultur-Management |
| 5.2 |
Qualitätsmanagement |
| 5.3 |
Lean Management |
| 5.4 |
Controlling |
| 5.4.1 |
Klassisches Controlling |
| 5.4.2 |
Balanced Scorecard |
| 5.5 |
Fazit |
| 6 |
Sportmanagement als Beruf |
| 6.1 |
Berufsbild versus Alltag: Der Beitrag von Henry Mintzberg |
| 6.2 |
Tätigkeiten und Qualifikationen |
| 6.3 |
Rekrutierung |
| 6.4 |
Professionalisierung |
| 7 |
Fazit |
| Literatur |
| Index |

1 Einleitung oder was ist ein Sportmanager?
Im Alltag erscheinen Begriffe oft sehr klar. Aber schaut man genauer hin, fangen die Probleme an. Dabei ist die genaue Definition eines Begriffs unerlässlich, damit sinnvoll argumentiert werden kann. Daher beginnt dieses Buch auch mit der Frage: Was ist Sport, wer oder was ist ein Manager bzw. ein Sportmanager? Es geht um den Ort ihrer Arbeit, den Organisationen und ein Versuch sie in drei Typen einzuteilen sowie um die Abgrenzung von Sportmanagement und Sportökonomie.
1.1 Was ist Sport?
Die Frage, was Sport ist, erscheint zunächst banal und fast überflüssig. Tatsächlich ist die Antwort schwieriger und weitreichender als in der Regel angenommen wird. Eine akzeptierte und damit allgemeingültige Definition des Begriffs wurde in der Sportwissenschaft bislang nicht gefunden (Digel 2013, 13ff, Strob 1999, 12ff). Als Beleg für die Schwierigkeit des Themas kann die Studie von Haverkamp (2005) gelten, die sich über immerhin ca. 250 eng bedruckte Seiten erstreckt. Die Spannbreite ist dabei ebenso beeindruckend wie die Komplexität der Definitionen. So definiert z.B. Tiedemann:
„Sport“ ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich freiwillig in eine Beziehung zu anderen Menschen begeben mit der bewussten Absicht, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten insbesondere im Gebiet der Bewegungskunst zu entwickeln und sich mit diesen anderen Menschen auf Grundlage der gesellschaftlich akzeptierten ethischen Werte nach selbst gesetzten oder übernommenen Regeln zu vergleichen.“ (Tiedemann 2012, 1)
Damit ist der Sport ein Teil der allgemeinen Kultur wie bspw. Volksmusik oder die deutsche Küche. Zudem ist er freiwillig. Damit wäre bemerkenswerterweise der Schulsport kein Sport, da er verpflichtend und nicht freiwillig ist. Weiter ist Sport immer Wettkampf bzw. die Vorbereitung auf den Wettkampf. Damit fallen alle Gesundheitssportaktivitäten, wie Rückengymnastik oder Joggen zum Abschalten, nicht unter dem Sportbegriff von Tiedemann. Auch die beliebtesten Sportaktivitäten der Deutschen – Spazierfahrten mit dem Fahrrad, Wandern (Preuß/ Alfs/Ahlert 2012, 97) – wären kein Sport. Pokern und Schach dagegen fallen unter die Definition.
Volkamer versteht dagegen unter Sport:
„Sport ist die willkürliche Schaffung von Aufgaben, Problemen oder Konflikten, die vorwiegend mit körperlichen Mitteln gelöst werden. Die Lösungen sind beliebig wiederholbar, verbesserbar und übbar, und die Handlungsergebnisse führen nicht unmittelbar zu materiellen Veränderungen.“ (Volkamer 1984, 196)
Читать дальше