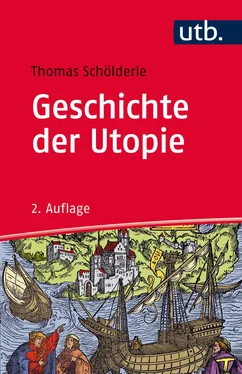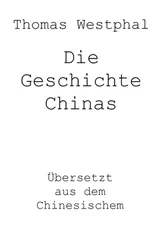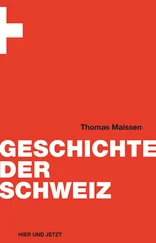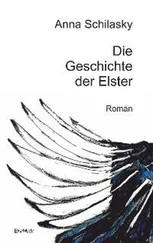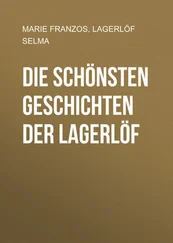Der Streit um den Vorzug von vita actica oder vita contemplativa war für die Humanisten der damaligen Zeit nichts Neues; die Entscheidung betraf ein unmittelbares Problem. Die Humanisten formten ein neues Bild, eine neue Stellung des Menschen, die sich deutlich von der hierarchischen Abstufung des Mittelalters unterschied. Sie bemühten sich um eine neue, wesensgemäße Bestimmung von Herrschaft, Bildung, Gesetz, Eigentum und Strafe; und sie versuchten nicht nur Gehör bei den Trägern der politischen Macht zu finden, sondern traten meist selbst in den Dienst der Fürsten, um sich dort aktiv für die Umsetzung ihrer Ideen einzusetzen. Auch Morus selbst sah sich vor diese Entscheidung gestellt, und er hat sich die Antwort keineswegs leicht gemacht. Sein Leben ist ein beständiges Schwanken zwischen den Polen der rein geistigen Existenz eines christlichen Gelehrten und der aktiv-politischen als Staatsmann. Die zentrale Stellung der Berater-Thematik nährt daher den Verdacht, dass Morus an dieser Stelle, argumentativ und kontrovers, einen Grundkonflikt seines eigenen Lebens ausgetragen hat. Überzogen freilich scheint es, darin sogar den tiefen psychologischen Konflikt einer gespaltenen Persönlichkeit zu erblicken, die zeitlebens bereut hat, nicht Mönch geworden zu sein. 37Das Dilemma beschäftigte schließlich nicht nur Morus, sondern den gesamten christlichen Humanismus der damaligen Zeit.
Das zweite Buch, rund zwei Drittel des Textes, ist dann ganz auf die Beschreibung Utopias konzentriert. Raphaels Schilderung folgt dabei keiner strengen oder konsequenten Gliederung. Dennoch ist die Darstellung inhaltlich erschöpfend und kennt im Wesentlichen fünf größere, aufeinander aufbauende Kapitel: Die Schilderung beginnt mit der geografischen Lage, der Landesstruktur und den Städten Utopias. Im Anschluss folgt die Beschreibung der sozioökonomischen Ordnung (Arbeit, Handel, Freizeit), ehe der Bericht zur utopischen Lebensphilosophie, der Ethik und dem Erziehungs- und Bildungssystem übergeht. Der vierte Abschnitt mit der Schilderung des Kriegswesens und den Hinweisen auf Verbrecher, Sklaven und Ehebrecher verdunkelt dann in Teilen das Bild. Die zentrale Bedeutung des Kapitels liegt in der Abweichung von der bis dahin weitgehend positiven Normgestalt des utopischen Gemeinwesens. Der fünfte und letzte Abschnitt konzentriert sich schließlich auf die Religion der Utopier, einschließlich der Behandlung der Todesthematik. Willi Erzgräber spricht aufgrund des Aufbaus daher von einer insgesamt „dramatischen“ Linienführung. 38Die Hinweise zum formalen Aufbau sollen hier vorerst genügen, weil sich an späterer Stelle noch eine genauere Analyse des utopischen Staatswesens anschließen wird.
In der Schlussszene wird die Dialogsituation wieder aufgenommen. In einem leidenschaftlichen Plädoyer für das utopische Gemeinwesen bricht Raphael mit seiner anfangs quasi-neutralen Berichterstattung. Der „Dialog-Morus“ reagiert ausweichend. Sein Verweis auf das anstehende Abendessen setzt dem Gespräch ein vorzeitiges Ende. Morus lobt sowohl die beschriebenen Einrichtungen wie die Rede des Raphael. Seine Bedenken, namentlich gegenüber der Kriegspolitik, der Religion und der kommunistischen Lebensweise der Utopier, formuliert Morus nicht mehr an die Adresse Raphaels, sondern richtet sie direkt an den Leser. Er schließt mit dem Satz: „Inzwischen kann ich zwar nicht allem zustimmen, was er gesagt hat, obschon er unstreitig sonst ein ebenso gebildeter wie welterfahrener Mann ist, jedoch gestehe ich gern, daß es im Staate der Utopier sehr vieles gibt, was ich unseren Staaten eher wünschen möchte als erhoffen kann.“ 39Damit endet die Utopia. Der zentrale Aspekt einer endgültigen Bewertung des Gesagten wird vertagt. Ein solcher Schluss ist im Grunde noch gar keiner. Das Ende ist bewusst offen gelassen; und es ist nun am Leser, Raphaels Standpunkte im Einzelnen zu prüfen. Die Erzählstruktur führt zu einer argumentativen Pattsituation, die verhindert, dass sich der Leser vorbehaltlos auf die eine oder andere Seite schlagen kann. Die Aufgabe des Nachdenkens und der Bewertung wird dem Publikum übertragen und in dieser Weise ist der Aufruf zur eigenen Urteilsbildung ebenso unverkennbar wie die Parallele zu Platons Dialogen.
Von zentraler Bedeutung für das Verständnis der gesamten Schrift sind die dort auftretenden Personen. Die schillerndste Gestalt ist zweifellos der einzige, frei erfundene Charakter: Raphael Hythlodaeus. Ein erster Zugang erschließt sich über seinen Nachnamen. Dieser nämlich enthält – wie schon die Utopia-Wortschöpfung – zwei griechische Begriffe: „hýthlos“ heißt Posse oder Geschwätz; bei dem Wort „dáios“ ist allerdings die Betonung entscheidend: dāios (mit langem a) heißt „feindlich“, demzufolge wäre Raphael der Feind des Geschwätzes oder eben: der inhaltsschwere, weise Philosoph. Liest man jedoch dăios (mit kurzem a), wie es die meisten Interpreten tun, dann erhält man Raphael, den Schwätzer und Possenerzähler, denn das Wort bedeutet so viel wie „erfahren“ oder „kundig“. 40Dass allein damit das Vorzeichen der gesamten Utopia-Schilderung wechselt, liegt auf der Hand. Doch nicht einmal das ist wirklich eindeutig: Selbst bei einer unzweideutigen Übersetzbarkeit könnte der Name im Sinne humanistischer Satire noch immer ironisch gemeint sein.
Im Text wird Hythlodaeus zunächst vorgestellt als ein ehemaliger Reisebegleiter des Amerigo Vespucci. Morus hält ihn deshalb anfänglich für einen Seemann, doch Gilles entgegnet ihm: „Weit gefehlt! (…) Jedenfalls fährt er nicht zur See wie Palinurus, sondern wie Odysseus oder, besser gesagt, wie Platon.“ 41Der Platon-Vergleich, die Seefahrt und die Weltentdeckung sind unverkennbar Hinweise und Metaphern für philosophische Wahrheitssuche. Der Verweis auf Platon bereitet zudem Raphaels Thema vor: die Frage nach dem „besten“ Staat. Konzipiert ist die Figur als deutliche Kontrastfolie zu den übrigen Personen der Erzählung. Im Gegensatz zu Morus und Gilles kennt Raphael weder private noch berufliche Pflichten. Auch sein gesamtes Vermögen hat er bereits zu Lebzeiten seinen nächsten Verwandten vererbt, um sich auf diese Weise von jeder sozialen Verantwortung freizukaufen.
Darüber hinaus ist Raphael ein großer Vereinfacher. Ablesen lässt sich das an seinem Diktum, wonach alle Besitzenden unnütz und frevelhaft seien, Arme und Besitzlose dagegen prinzipiell bescheiden und gut. Mit der Abschaffung des Geldes, so Raphael, werde auch die Geldgier verschwinden und damit zugleich Betrug, Raub, Mord, Streit, Furcht und Sorgen. 42Hythlodaeus verkürzt nicht nur gern, bisweilen verfängt er sich sogar in groteske Widersprüche. So entwirft ausgerechnet er – die Losgelöstheit in Menschengestalt – das Bild eines Gemeinwesens, in dem das Kollektivinteresse über jede individuelle Selbstbestimmung triumphiert. Ferner besitzt Raphael eine besondere Vorliebe und Gabe, um von politischen Einrichtungen fremder Länder zu berichten. Auf der Insel Utopia gelten Diskussionen über Politik, außerhalb von Senat und Volksversammlungen, allerdings als Hochverrat. 43Raphael ist zudem ein Weitgereister; in Utopia aber muss man sich für jedes Verlassen des Wohnbezirks einen Erlaubnisschein holen und reist im Normalfall in der Gruppe. Außerdem besteht Raphael während seiner Ausführungen explizit darauf, nur von den „Einrichtungen zu berichten, nicht aber diese zu rechtfertigen.“ 44Gegen Ende seiner Rede formuliert er jedoch ein derart flammendes Plädoyer für die Utopier, dass er seine angeblich neutrale Haltung damit völlig ad absurdum führt. 45Fast noch kurioser ist die Diskussion um die Todesstrafe: Im ersten Buch der Utopia begründet Hythlodaeus seine Ablehnung, selbst Diebe zum Tode zu verurteilen, mit so grundsätzlichen, christlich-humanistischen Argumenten, dass eine Revision seines Standpunkts nicht mehr möglich scheint: „Gott hat verboten zu töten, und wir töten so leicht wegen eines entwendeten Groschens (…). Nun hat uns Gott aber nicht nur die Verfügung über das fremde, sondern auch über das eigene Leben entzogen.“ 46Nur kurz darauf lobt Raphael allerdings beim Volk der Polyleriten, und später dann auch bei den Utopiern selbst, die dort praktizierte Todesstrafe. 47Überdies kennen die Utopier sogar die staatlich erlaubte, ja geförderte Euthanasie.
Читать дальше