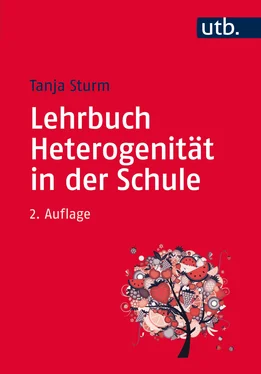milieugeprägter Umgang mit den Regeln
Die Mitglieder einer Organisation gehören sozialen Milieus an. Wenn habituelle Handlungsweisen und Praktiken, ihre milieugeprägte Alltagsgestaltung, das Handeln der Mitglieder auch im organisatorischen Kontext der Schule kennzeichnen, liegen milieugeprägte Umgangsweisen mit formalen Regeln vor. Dies erfolgt dann problemlos, wenn die formalen Regeln der Schule mittels des konjunktiven Erfahrungswissens verstanden und die damit verbundenen Erwartungen in den Praktiken realisiert werden.

Hannah ist in einer Familie sozialisiert, in der sie in ihrem Alltag herausgefordert ist, Entscheidungen zu treffen, z. B., ob sie lieber einen Apfel oder eine Banane essen möchte. Wird sie von ihren Eltern oder ihren älteren Geschwistern dazu aufgefordert, kann Hannah ihre Auswahl für das eine oder das andere auch begründen. Wenn Hannah im Unterricht aufgefordert wird zu begründen, warum sie sich im Rahmen der Wochenplanarbeit für Aufgaben aus dem Fach Mathematik entschieden hat, kann sie dies. Sie wendet die von zu Hause gewohnte Praktik an, Entscheidungen zu treffen und sie zu begründen. Hannah kann die formale Regel, ihre Arbeitsschritte zu begründen, aus ihrem Milieu heraus verstehen und bearbeiten.
informelle Regeln
Die dritte Variante der Bearbeitung formaler Regeln besteht in ihrer Konkretisierung durch informelle Regeln im Sinne eines Organisationsmilieus. Dieses Prinzip findet sich dort, wo mittels konjunktivem Verständnis der Organisationsmitglieder eine formale Regel in die Praxis übersetzt wird. Praktiken, die sich dabei als erfolgreich erweisen und sich derart durchsetzen, dass sie überindividuellen Charakter annehmen, werden als „Organisationsmilieu“ bezeichnet. Sie stellen eine Konkretisierung der formalen Regel dar, die sich von einer direkten Handlungsbeschreibung unterscheidet. Sie bedürfen, wie für Milieus typisch, keiner Explikation, sondern beruhen auf Verstehen (Nohl 2007, 69 f).

Sezen ist mit ihrer Familie in eine andere Stadt gezogen und besucht eine neue Schule. Die Art und Weise wie ihre neue Lehrerin, Frau Stein, Schüler / -innen auswählt, die im Morgenkreis etwas berichten dürfen, unterscheidet sich von der, die sie aus ihrer alten Schule kennt. Sezen kann sich an den anderen Schüler / -innen orientieren, sie kann diese und ihre Praktiken, die informellen Regeln folgen, beobachten. Dies kann mimetisch und vorreflexiv erfolgen und ist nicht auf explizite Kommunikation angewiesen.
Organisationsmilieus
Die Entwicklung von Organisationsmilieus kann – langfristig – in die Formulierung formaler, neuer Regelungen münden. Hier manifestiert sich neues habituelles Handeln in der Organisation. Es ist dem eines Milieus vergleichbar, da es durch die Beobachtung anderer und mimetischer Lernprozesse angeeignet wird und den Akteuren und Akteurinnen in der Regel ausschließlich vorreflexiv zur Verfügung steht (Nohl 2010, 203 f).
Die kollektiv geteilten Regeln der Interpretation formaler Regeln beinhalten die impliziten Wissensbestände, die in der Organisation neu entstanden sind. Das so entstandene Organisationsmilieu wird folglich erst durch die Mitgliedschaft zur Organisation möglich. Die Mitgliedschaftsrolle ist also notwendige Voraussetzung für die Entwicklung einer organisationalen Milieuzugehörigkeit. Wie soziale Milieus auch, sind Organisationsmilieus vielschichtig und mehrdimensional. Innerhalb einer Schule lässt sich z. B. das Organisationsmilieu der Lehrkräfte von dem der Schüler / -innen unterscheiden, das wiederum in sich vielschichtig ist bzw. sein kann. Dass Schulen sich stark voneinander unterscheiden, ist Ausdruck unterschiedlicher Organisationsmilieus (Nohl 2007, 70).
Milieus in Organisationen
Die Handlungspraktiken innerhalb einer Organisation sind entsprechend durch zwei unterschiedliche Milieutypen bedingt: jene sozialen Milieus, denen die Organisationsmitglieder angehören und die sie in die Organisation einbringen und jene, die sich in der Organisation selbst entwickeln. Diese sind nicht identisch, stehen jedoch in Relation zueinander respektive sind aufeinander bezogen (Nohl 2010, 206).
Diskriminierung
Schule als Ort milieuübergreifender Verständigung und systematischer Benachteiligungen sozialer Gruppen: Sowohl die Strukturen, d. h. die formale Ebene, als auch die Praktiken in Organisationen bergen Risiken systematischer Benachteiligungen und Schlechterstellungen spezifischer Schülergruppen. Innerhalb von Organisationen kann dies als „Diskriminierung“ bezeichnet werden. Nohl (2010) hat unter Bezugnahme auf die soziologischen Arbeiten Luhmanns, Goffmans, Ortmanns und Bohnsacks ein Verständnis von „Organisation“ und „Diskriminierung“ entwickelt, das dies zu fassen ermöglicht (Nohl 2010, 195 ff). Die Ausführungen Bourdieus (1998) erweitern die Überlegungen Nohls (2010) um den expliziten Verweis auf die historische Entstehung formaler Regeln, in denen vorangegangene Auseinandersetzungen und Machtpositionen enthalten sind. Dies spiegelt sich zum einen in den Strukturen der Organisation der Schule wider, zum anderen in den kulturellen Praktiken, die im und durch das Organisationsmilieu tradiert werden.
Die Organisation der Schule eröffnet mithin Potenziale, um Lernen, Bildung und Sozialisation über die Grenzen von Milieus hinweg zu gestalten, und birgt zugleich Risiken systematischer Benachteiligung, also der Diskriminierung von Schüler / -innen bzw. von Schülergruppen. Eindimensionale Betrachtungen, die nur eine Milieudimension in den Blick nehmen, werden als „totale Identifizierung“ bezeichnet. Wird diese Reduktion auf eine Erfahrungsdimension herangezogen, um die Handlungen und Praktiken einzelner Personen infrage zu stellen – und entlang dieser Zuschreibungen auch den Zugang oder die Mitgliedschaft innerhalb einer Organisation –, so ist dies diskriminierend. Im Rahmen von Organisationen finden diese Diskriminierungen im interaktiven Austausch der Beteiligten statt und können zugleich durch den organisatorischen Prozess hervorgebracht werden; als solche sind sie hochkomplex, da sich mehrere potenzielle Dimensionen miteinander verbinden und auch konfligieren können. Jenseits totaler Identifizierungen finden sich jene Identifizierungen, die nicht im Vorwege, sondern im Nachhinein mit Diskriminierung verknüpft werden, z. B. wenn festgestellt wird, dass eine soziale Gruppe schlechter gestellt ist als eine andere (Nohl 2010, 216 f).
Reifizierungsproblem
Es gibt soziale Gruppen oder Milieus, die innerhalb von Schule kontinuierlich gegenüber anderen schlechter gestellt sind (Nohl 2010, 213). Der Begriff „soziale Gruppe“ bezieht sich hier nicht auf real vorhandene, sondern auf konstruierte Gruppen, wie beispielsweise „die Mädchen“. In der Beschreibung selbst wird das Reifizierungsproblem deutlich: Dass derartige Gruppen einerseits umschrieben werden müssen, um Diskriminierungspraktiken identifizieren zu können (z. B. in der statistischen Betrachtung von Benachteiligungen der Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem); durch die Beschreibung der Gruppe wird diese andererseits als solche aber auch konstruiert und – in einer eindimensionalen Perspektive – betrachtet. Derartige Identifizierungen schließen andere Milieudimensionen aus, denen die Schüler / -innen ebenfalls angehören.
habitualisierte Zuschreibungen
Die Mitgliedschaft zu Organisationen unterscheidet zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Bezogen auf die Schule als Organisation insgesamt sind fast alle Kinder und Jugendlichen, die in Deutschland leben, Mitglieder in ihr, wenn auch in unterschiedlichen Suborganisationen, den verschiedenen Bildungsgängen bzw. Schulformen (in einigen Bundesländern sind Schüler / -innen ohne legalen Aufenthaltsstatus vom Schulbesuch ausgeschlossen (Gogolin 2011, 55)). Derartige Zuschreibungen können habitualisiert erfolgen, also unreflektiert und sich im Sprachgebrauch niederschlagen.
Читать дальше