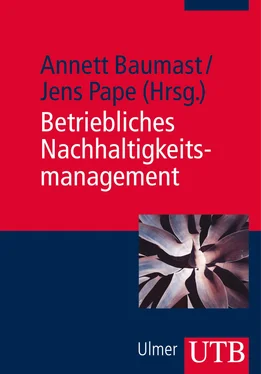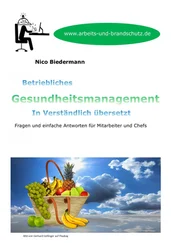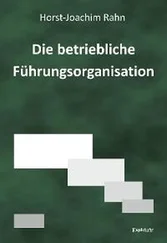3.3Fallstudie „Nachhaltigkeit in den Lieferantenbeziehungen“
3.3.1Zielsetzung und Aufbau
3.3.2Elemente des Nachhaltigkeitskonzepts
3.3.3Weltweite Umsetzung von Nachhaltigkeits-konzepten
3.4Schlussbetrachtung
3.5Übungsfragen
3.6Weiterführende Literatur
4Standards und Zertifikate im Umweltmanagement, im Sozialbereich und im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung
4.1Klassifizierungen von Umweltmanagement- und Sozialstandards
4.2Die Entstehung und Entwicklung von Umweltmanagement- und Sozialstandards
4.3Die Norm DIN EN ISO 14001
4.3.1Der Ablauf der ISO 14001
4.3.2Die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001:2009
4.4Die EMAS-Verordnung
4.4.1Der Ablauf einer Zertifizierung nach EMAS
4.4.2Das Validierungssystem von EMAS
4.5Social Accountability 8000 (SA 8000)
4.5.1Der Ablauf der SA 8000
4.5.2Das Zertifizierungssystem der SA 8000
4.6„Code of Labour Practices“ der Fair Wear Foundation (FWF)
4.7Standard für Arbeitsschutzmanagement (OHSAS 18001)
4.8Forest Stewardship Council
4.9DIN ISO 26000-Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung
4.10Stakeholder-Dialoge als Grundlage für Umwelt- und Sozialstandards
4.11Ausblick
4.12Übungsfragen
4.13Weiterführende Literatur
TEIL III: Nachhaltige Unternehmen und ihr Umfeld
5Nachhaltigkeit und Kapitalbeschaffung von Unternehmen
5.1Finanzierungsmöglichkeiten von Unternehmen: Kapitalbeschaffung
5.2Kapitalbeschaffung für nachhaltige Unternehmen außerhalb der Börse
5.2.1Unternehmens- und Projektfinanzierungen
5.2.2Rechtliche Stellung von Kapitalgebern: Berücksichtigung von Anspruchsgruppen?
5.2.3Aufteilung des Gesamtemissionsvolumen des Kapitals: die Stückelung
5.2.4Laufzeiten der Kapitalüberlassung
5.2.5Kapitalbeschaffung und Kommunikation
5.3Nachhaltigkeit und Kapitalbeschaffung an der Börse
5.3.1Eine kurze Geschichte nachhaltiger Anlagen
5.3.2Von Best-in-Class bis Themenansatz: Aktien und Anleihen nachhaltiger Unternehmen
5.3.3Der Börsengang: nachhaltige Kapitalbeschaffung
5.4Fallbeispiel New Value AG
5.5Übungsfragen
5.6Weiterführende Literatur
6Corporate Citizenship – Unternehmen als politische Akteure
6.1Zur Rolle von Unternehmen im Zeitalter der Globalisierung
6.2Begriffsabgrenzung und Charakterisierung von Corporate Citizenship
6.2.1Der „Limited“ und der „Equivalent View of Corporate Citizenship“ im Verhältnis zu Corporate Social Responsibility
6.2.2Der Extended View of Corporate Citizenship im Lichte bürgerschaftlicher Rechte
6.3Illustrative Fallbeispiele unternehmerischen Verhaltens
6.3.1Unternehmen und soziale Rechte („Versorger“ und „Verweigerer“)
6.3.2Unternehmen und zivile Rechte („Förderer“ und „Unterdrücker“)
6.3.3Unternehmen und politische Rechte („Kanalisatoren“ und „Blockierer“)
6.4Ebenen unternehmerischen Einflusses auf bürgerschaftliche Rechte
6.5Nutzen und Grenzen des Konzepts Corporate Citizenship
6.6Übungsfragen
6.7Weiterführende Literatur
TEIL IV: Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis
7Nachhaltigkeit und Strategie
7.1Nachhaltigkeit in Unternehmensstrategien
7.2Nachhaltigkeit im Zielsystem von Unternehmen
7.3Fallbeispiele
7.3.1Vorreiter Patagonia – Nachhaltigkeit als Unternehmensstrategie
7.3.2Chiquita – Wandel eines Konzerns in Richtung Nachhaltigkeit durch strategische Entscheidungen
7.3.3GIZ – Nachhaltige Entwicklung als Dienstleistung
7.4Schlussfolgerungen
7.5Übungsfragen
7.6Weiterführende Literatur
8Leadership für nachhaltiges Wirtschaften
8.1Definition nachhaltiger Führung
8.2Nachhaltiges Wirtschaften und seine Implikationen für ein Führungsverständnis
8.3Traditionelle Führungsansätze und ihre Grenzen für nachhaltiges Wirtschaften
8.4Transformationale Führung
8.5Nachhaltigkeitsorientierte Gestaltungsansätze im Rahmen transformationaler Führung: heterogene Teams als Ressource
8.5.1Potenziale und Herausforderungen heterogen besetzter Teams
8.5.2Führungsanforderungen in heterogenen Teams und die Potenziale transformationaler Führung
8.6Fallbeispiel Siemens
8.6.1Die jüngere Entwicklung von Siemens
8.6.2Die aktuelle Vision und Strategie von Siemens
8.6.3Führung und Diversität bei Siemens
8.7Neues Leadership-Verständnis?
8.8Übungsfragen
8.9Weiterführende Literatur
9Integrierte Managementsysteme
9.1Entwicklung standardisierter Managementsysteme
9.2Integrationsansätze
9.2.1Integrationsansätze auf Basis eines standardisierten Managementsystems
9.2.2Systemunabhängige Integrationsansätze
9.3Vor- und Nachteile integrierter Managementsysteme
9.4Integrationsschwerpunkte
9.5Fallstudien
9.5.1Volkswagen AG
9.5.2BMW Group
9.6Übungsfragen
9.7Weiterführende Literatur
10Umweltmanagementansätze
10.1Umweltmanagementansätze – ein Weg zur vereinfachten Einführung von EMAS
10.1.1EMASeasy
10.1.2EMAS-Konvoi
10.1.3Kirchliches Umweltmanagement – der Grüne Gockel
10.1.4Stufenweise Einführung eines Umweltmanagementsystems nach ISO 14005
10.2Umweltmanagementansätze – Umsetzung einzelner Elemente betrieblicher Umweltmanagementsysteme
10.2.1Ökoprofit – Ökologisches Projekt für integrierte Umwelt-Technik
10.2.2PIUS – Produktintegrierter Umweltschutz
10.2.3Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe
10.3Potenzielle Erfolgsfaktoren von Umweltmanagementansätzen
10.4Fallbeispiel: Anwendung von EMASeasy an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH)
10.4.1Kurzporträt der Hochschule
10.4.2Leitbild und Umweltleitlinien der HNE Eberswalde (FH)
10.4.3Ein nicht immer leichter Weg – EMASeasy
10.4.4EMASeasy – mit Ecomapping zum Umweltmanagementsystem
10.5Schlussbetrachtung
10.6Übungsfragen
10.7Weiterführende Literatur
TEIL V: Messung und Steuerung nachhaltiger Leistungen von Unternehmen
11Nachhaltigkeitscontrolling
11.1Ziele und Themenfelder des Nachhaltigkeitscontrollings
11.2Konzepte und Aufgaben
11.3Strategisches Nachhaltigkeitscontrolling
11.4Instrumente des Nachhaltigkeitscontrollings
11.4.1Überblick und grundsätzliche Anforderungen
11.4.2Nachhaltigkeitsorientierte Analyse von Produkten und Prozessen
11.4.3Nachhaltigkeitsorientierte Analyse operativer Risiken
11.4.4Nachhaltigkeitsorientierte Kosten- und Investitionsrechnung
11.4.5Nachhaltigkeitsorientierte Kennzahlen(-systeme)
11.5Fallstudie: Nachhaltigkeitscontrolling bei der BMW Group
11.6Übungsfragen
11.7Weiterführende Literatur
12Ökobilanzierung und Stoffstrommanagement
12.1Produktbezogene Ökobilanzierung
12.1.1Entwicklung der produktbezogenen Ökobilanzierung
12.1.2Bestandteile einer Produkt-Ökobilanz
12.1.3Definition von Bilanzierungsziel und Umfang
12.1.4Sachbilanz
12.1.5Wirkungsbilanz
12.1.6Auswertung/Interpretation
12.1.7Streamlining und Screening der Ökobilanz
12.2Weiterentwicklung zum Stoffstrommanagement
12.3Fallstudie
12.3.1Zieldefinition
12.3.2Sachbilanz und Wirkungsbilanz
12.3.3Ergebnisse
12.4Übungsfragen
12.5Weiterführende Literatur
13Nachhaltiges Management von Wertschöpfungsketten
13.1Begriffliche Grundlage: Supply Chain Management
13.2Zielgrößen des Supply Chain Managements
13.3Strategien eines nachhaltigen Managements von Wertschöpfungsketten
13.3.1Ausgangspunkte eines nachhaltigen Managements von Wertschöpfungsketten
Читать дальше