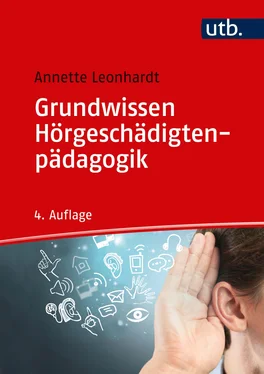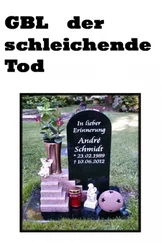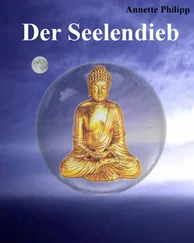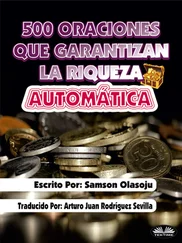Annette Leonhardt
Hinweise zur Benutzung dieses Lehrbuches
Dieses Lehrbuch soll das notwendige Basiswissen für eine Hörgeschädigtenpädagogik vermitteln. Am Ende jedes Kapitels sind Übungsaufgaben angefügt zur eigenen Lernkontrolle. Ein Glossar ist im Anhang abgedruckt. Zur schnelleren Orientierung wurden in den Randspalten Piktogramme benutzt, die folgende Bedeutung haben:
 |
Definition |
 |
Beispiel |
 |
Informationsquelle |
 |
Übungsaufgaben am Ende der Kapitel |
Online-Zusatzmaterial
Die Antworten zu den Übungsaufgaben gibt es unter www.utb-shop.deund www.reinhardt-verlag.de.
1 Wer ist hörgeschädigt?
Hören ist eine Fähigkeit, deren Bedeutung der Mensch mit einem voll funktionsfähigen Gehör fast immer unterschätzt. Spontan macht sich kaum jemand Gedanken darüber, in welchem Maß die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt beeinträchtigt wird, wenn das Hören ausfällt oder nur eingeschränkt möglich ist. Je länger man jedoch über eingeschränktes oder ausgefallenes Hören nachdenkt, umso mehr wird die Tragweite bewusst: Der zwischenmenschliche Kontakt erlebt erhebliche Beeinträchtigungen; die Kommunikation mit anderen Menschen kann nicht ungehindert ablaufen.
Für den Normalhörenden ist es in der Regel etwas Selbstverständliches, dass er die Sprache anderer Menschen hören und verstehen kann, dass er sein eigenes Sprechen und Singen zu hören und zu kontrollieren vermag und dass es ihm zu jeder Zeit möglich ist, eine Vielzahl von Klängen und Geräuschen (z. B. Tierlaute, Naturerscheinungen, Warnsignale, Maschinenlärm) wahrzunehmen. Den Wert des Hörens für die Entwicklung eines Menschen erkennt man eigentlich erst dann, wenn die Funktionstüchtigkeit des Hörorgans herabgesetzt oder wenn es gänzlich funktionsuntüchtig ist.
Einige Fallbeschreibungen sollen erste Informationen bieten und mögliche Auswirkungen illustrieren. Lassen wir – um eine konkrete Anschauung der Situation zu vermitteln – fünf sehr unterschiedliche Beispiele wirken:

Fallbeschreibung 1: Johannes L., 4;6 Jahre, hochgradig schwerhörig beiderseits
Johannes kam als erstes Kind nach komplikationsloser Schwangerschaft auf die Welt. Er entwickelte sich zunächst außerordentlich gut. Er war gleichaltrigen Kindern in vielen Entwicklungsschritten überlegen, so konnte J. mit 6 Monaten krabbeln und mit 9 Monaten frei laufen. Er war aufgeweckt und freundlich.
Mit ca. 9 Monaten begann er zu lallen und babbelte Silben wie „dadada“. Mit 1;6 Jahren sprach er einige (wenige) Wörter, z. B. Auto, hei (heiß), gah (Kran) oder dada (Papa). Sein Wortschatz vergrößerte sich jedoch nicht. So konnte J. mit knapp 2 Jahren noch immer keine weiteren Wörter sprechen. Da J. sich aber in allen anderen Bereichen gut weiterentwickelte, waren die Eltern zunächst nicht beunruhigt und dachten, wie auch Verwandte und Freunde der Familie, dass er zum Sprechenlernen etwas länger brauche.
Da J. aber auch nicht auf das Zurufen seines Namens reagierte, wurden die Eltern zunehmend verunsichert, und es kam ihnen der Gedanke, dass er vielleicht nicht gut hören könne. Sie stellten J. daraufhin dem Kinderarzt vor, der ihnen zunächst riet, noch ein Vierteljahr abzuwarten und, falls J. dann noch nicht spricht, einen Hörtest machen zu lassen.
Da J. nach diesen 3 Monaten immer noch nicht mehr sprach, überwies der Kinderarzt die Eltern an die für den Wohnort zuständige Universitätsklinik, um dort einen Hörtest und eine BERA (Hirnstammaudiometrie) durchführen zu lassen.
Der Verdacht der Schwerhörigkeit bestätigte sich: J. war beidseitig hochgradig schwerhörig.
J. bekam mit 2;6 Jahren die ersten Hörgeräte. Zeitgleich setzte die Früherziehung mit einer Stunde pro Woche ein. Die Hörgeräte wurden von J. von Anfang an gut akzeptiert; es zeigte sich sehr bald, dass er mit ihnen etwas wahrnehmen kann. Er reagierte auf Zurufe und sprach nach zwei Monaten Wörter nach. Sein Wortschatz begann rasch anzuwachsen.
Im folgenden halben Jahr wurden noch andere Hörgeräte ausprobiert. Die Hörgeräte, die er heute trägt (mit 4;7 Jahren), besitzt er seit dem 3. Lebensjahr.
Mit 3;6 Jahren kam J. in einen Waldorfkindergarten. Seit dieser Zeit wuchs sein Wortschatz rasch an. Er kommt im Kindergarten gut zurecht, kann sich mit den anderen Kindern verständigen und wird von ihnen akzeptiert. Für sein Alter hat er einen vergleichsweise umfänglichen Wortschatz und spricht vollständige Sätze. Seine Aussprache ist oft noch verwaschen, sein Sprachverständnis ist gut.
Die Entwicklungsperspektiven sind gegenwärtig noch offen. Die Eltern hoffen auf einen Besuch der allgemeinen Schule (nach: HörEltern 1998, 7 – 9).

Fallbeschreibung 2: Kristina Sch., hochgradig schwerhörig, an Taubheit grenzend, Studentin des Lehramts an Sonderschulen mit der vertieft studierten Fachrichtung Gehörlosenpädagogik
Sie beschreibt ihr Leben so: „Der Hörverlust ist auf der rechten Seite etwa 95 dB und auf der linken Seite 110 dB. Ich habe nur sehr geringe Hörreste, die ich aber mit meinen HdO-Geräten beiderseits sehr gut verwerten kann.
Als ich ungefähr 9 Monate alt war, bekamen meine Eltern langsam den Verdacht, dass ich nicht hören könne. Sie bemerkten, dass ich immer weniger und monotoner lallte, anstatt in die 2. Lallperiode zu gelangen. Außerdem habe ich immer seelenruhig weitergeschlafen, obwohl in der Nachbarschaft die Kinder sehr laut waren. Daraufhin experimentierten meine Eltern selbst mit mir, ob ich auf Geräusche reagieren würde. Das war sehr schwierig, da ich relativ schnell mit den Augen bin. Da sich ihr Verdacht bestätigte, wurden sie vom Kinderarzt zu einem HNO-Arzt vermittelt. Nach dessen Diagnose, dass ich ,stocktaub’ sei, wurde ich in die Universitätskliniken in Würzburg überwiesen. Dort wurde dann die Diagnose ,hochgradige, an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit’ gestellt. Für meine Eltern war es natürlich ein großer Schock. Dennoch fassten meine Eltern den Entschluss, dass sie mich nicht als Behinderte behandeln wollten, sondern wie ein normales hörendes Kind. So war für sie der wichtigste Grundsatz: ,Wir werden unser Kind so behandeln, als ob es nicht behindert wäre.’ Damit ist gemeint, dass sie mich nicht übermäßig behüten wollten oder mir etwas erlaubten, was sie mir normalerweise nicht erlaubt hätten, und dies nur taten, weil sie Mitleid mit mir hatten, so nach dem Motto: ,Ach, lass das Kind, es kann ja nicht hören.’
Ich war in meinen ersten Lebensjahren ein recht ,wildes’ Kind: Ich rannte oft durch den Garten oder spielte mit meinem Vater. Ich hatte auch viele hörende Spielkameraden. Mein Vater hat mich oft durch die Luft geworfen, auf dem Spielplatz habe ich wie jedes andere Kind herumgetobt. Mir kam damals nie ins Bewusstsein, dass ich nicht normal höre wie die anderen Kinder.
Mit etwa 11 Monaten habe ich mein erstes Hörgerät bekommen: ein Taschengerät. Ich habe es sehr oft getragen. Es ist so zum festen Bestandteil meines Lebens geworden, dass ich mich heute sehr unwohl und hilflos fühle, wenn ich nichts höre.
Читать дальше