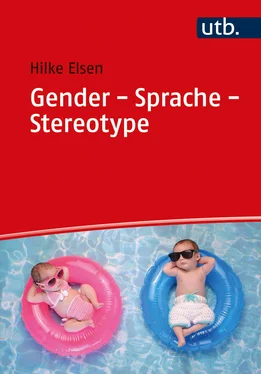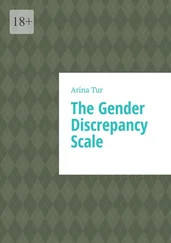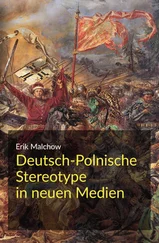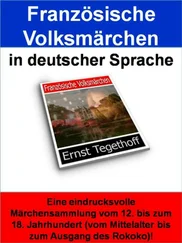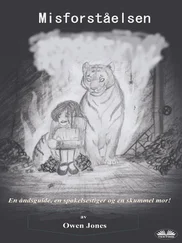Der soziolinguistischeSoziolinguistik, -isch Ansatz von Eckert/McConnell-Ginet (1999) dürfte für diejenigen relevant werden, die mit heterogenen Gruppen arbeiten. Allerdings ist die Situation in den USA nicht auf die deutschsprachigen Länder übertragbar. Hier müssen eigene Studien zeigen, wie EthnienEthnie und Dominanzstrukturen in Abhängigkeit der Herkunftsländer und der spezifischen Migrationssituation auf das Verhalten Einzelner innerhalb der Gruppe wirken und welche Rolle die Sprache spielt. Gergen (2010) diskutiert Prinzipien, Typen und Fragestellungen der qualitativen Forschung, Murnen/Smolak (2010) die der quantitativen Ansätze in der Genderforschung, sie können als Anstoß für eigene Vorhaben dienen. Auch in Nentwich/Kelan (2014: 132) finden wir Forschungsfragen.
Zur Vertiefung vgl. Meissner (2008). Nentwich/Kelan (2014) geben einen Überblick über Studien und Themen des Doing gender -Konzepts mit Schwerpunkt auf englischsprachigen Arbeiten. Sammelbände stammen von Braun/Stephan (2006), Günthner et al. (2012), Bergmann et al. (2012). Zu Feministischer LinguistikFeministische Linguistik vgl. Samel (2000), zu Queer Theory vgl. Laufenberg (2017), zu „Queerer Linguistik“ vgl. Motschenbacher (2012). Die Kritik an dem evolutionären Ansatz ist teilweise vehement und unterstellt zu starke Annahmen, für eine relativierende Position sei Newcombe (2010) genannt.
Bucholtz (2014) skizziert verschiedene feministische Strömungen, die auch Sprache mitberücksichtigen, aus US-Sicht. Sie zeigt, dass vermehrt die ethnische Perspektive, soziale Schicht, masculinity - sowie queer-studies in die Theoriebildung einfließen können und dass es sehr unterschiedliche Sichtweisen zum Verhältnis der Geschlechter untereinander sowie zu Macht und Gesellschaft gibt.
4. Sprache und Denken
4.1 Die Sapir-Whorf-HypotheseRelativität, sprachliche, Relativismus, Sapir-Whorf-Hypothese
Für viele Linguist/innen gilt es heute als selbstverständlich, dass sich neurologische, kognitiveKognition, kognitiv und soziale Aspekte beim Sprechen verbinden. Das GehirnGehirn verarbeitet gleichzeitig Weltwissen, kontextuell-gesellschaftliche Zusammenhänge, persönliche Informationen der Sprecher/innen und Sprache. Alles trifft gleichzeitig im Informationsverarbeitungssystem ein, wird verwaltet und zum Dekodieren von Mitteilungen herangezogen. Die modernen neurobiologischen und kognitiven Wissenschaften liefern hierzu immer mehr Beweise.
Innerhalb der (Sprach-)Wissenschaft ging jedoch nicht immer jede/r davon aus, dass zwischen Denken, Handeln und Sprache eine Verbindung bestehen könnte. Schon seit Aristoteles wird immer wieder die Auffassung vertreten, Sprache und KognitionKognition, kognitiv seien vielmehr getrennte Systeme und wechselseitige Einflüsse eher nicht anzunehmen. Demnach ist Sprache in sich geschlossen, objektiv fassbar und unabhängig vom Sprechen und von den Sprecher/innen. Also benötigen wir für das Denken keine Sprache, und Sprache bildet lediglich die Gedanken ab. Sprache folgt ihren eigenen Regeln, die bei allen Menschen gleich sind ( sprachlicher Universalismus Universalismus). Diese Ansicht fand seit Mitte des letzten Jahrhunderts große Verbreitung durch die Dominanz amerikanischer Sprachwissenschaftler, die sich primär auf das Englische stützten.
Demgegenüber vertraten andere die Auffassung einer direkten Verbindung. Neben einigen frühen Vorläufern wie Gottfried Herder oder Wilhelm von Humboldt gingen Franz Boas (1858–1942), Edward Sapir (1884–1939) und Benjamin Lee Whorf (1897–1941) Anfang des letzten Jahrhunderts explizit davon aus, dass Sprachen auf ihre Sprecher/innen einwirken. Dadurch können sie das Denken beeinflussen und mithin das Handeln ebenfalls. Somit ist die jeweilige Wirklichkeit eine relative und abhängig von Sprache und Kultur. Jede Kultur ermöglicht eine etwas andere Sicht der Welt, die sie unter anderem durch Sprache vermittelt. Eine Kultur, die in Schnee und Eis überlebt, muss zwangsläufig mehr Wörter für Schnee haben. Eine Kultur in der Wüste verfügt über mehr Begriffe von Brauntönen. Jede ist im Prinzip dazu in der Lage, die Dinge der Welt zu sehen, aber kulturell wählt sie nur bestimmte aus, die sie versprachlicht. Das gilt auch für grammatische Strukturen. Die Sprache filtert die Wahrnehmung, was unterschiedliche Realitäten in den Köpfen der Menschen mit sich bringt. Ein absolutes, einzig wahres Bild der Dinge gibt es daher nicht.
Ausgangspunkt in den USA waren ethnologische Beobachtungen mit der Erkenntnis, dass fremde Kulturen und ihre Sprachen einige bisher als selbstverständlich geltende Dinge anders ausdrückten und auch anders sahen, sowie der Versuch, möglichst objektiv-beschreibend und ohne Vorurteile vorzugehen. Denn zu diesem Zeitpunkt wurden die indigenen Völker und ihre Sprachen noch als weniger wertvoll als das Englische betrachtet und somit negativ bewertet.
Für die Vertreter der später so genannten Sapir-Whorf-Hypothese Relativität, sprachliche, Relativismus, Sapir-Whorf-Hypothese gilt der Einfluss der Sprache auf das Denken als zentral ( sprachlicher Relativismus ). Das beinhaltet jedoch nicht die Bestimmung, Abhängigkeit bzw. Festlegung des Denkens durch die Sprache ( sprachlicher Determinismus Determinismus) (vgl. auch Elsen 2014: 75ff.). Letzteres impliziert, dass Denken ohne Sprache nicht möglich ist, und schließt Änderungen der durch die Sprache vermittelten Auffassung der Welt aus, etwa durch den Erwerb einer weiteren Sprache. Damit wäre die geistige Freiheit gar nicht gegeben, aus dem durch die eigene Sprache auferlegten Gefängnis herauszukommen. Dies war jedoch gerade nicht im Sinne der Vertreter der Sapir-Whorf-Hypothese. Sie gingen vielmehr davon aus, dass die Beziehung zwischen Sprache und Denken eben eine relative ist und neue Sprachen, neue Strukturen, Wörter und Konzepte die bereits vorhandenen relativieren und erweitern.
Die Versprachlichung bestimmter Inhalte zwingt die Menschen dazu, darüber nachzudenken. So ist es im Deutschen zunächst unwichtig, ob wir gerade oder grundsätzlich etwas tun, während im Englischen wegen der Unterscheidung she eats meat oder she is eating meat durchaus darüber nachgedacht werden muss, weil immer eines von beiden formuliert wird. Ebenso sind für Spanischsprachige die beiden Zeitangaben mañana und madrugada selbstverständlich zu differenzieren, also, ob der Morgen früher oder später ist. Im Deutschen ist das nicht in jeder Situation relevant, und dann können wir auch immer noch anhand einer Zeitangabe präzisieren, welchen Zeitabschnitt wir meinen. Auch räumliche Angaben lassen sich unterschiedlich ausdrücken, etwa relativ zur eigenen Person oder anderen Orientierungspunkten wie im Englischen oder Deutschen, vgl. links von , vor . Daneben gibt es absolute Referenzrahmen, beispielsweise die Beschreibung mithilfe von Himmelsrichtungen, vgl. „‚[t]here’s an ant on your south-east leg‘ or ‚Move the cup to the north-northwest a little bit‘“ (Boroditsky 2009: 121) in Pormpuraaw, Australien. Die Sprecher/innen dort müssen sich stets über ihre lokale Position im Klaren sein, was dazu führt, dass sie sich auch besser in unbekanntem Terrain zurechtfinden im Vergleich zu Sprecher/innen des Englischen oder Deutschen. Versuche ergeben, dass wir beim Erwerb einer neuen Sprache auch entsprechende kognitiveKognition, kognitiv Fähigkeit erlernen (Boroditsky 2009, dort weitere Beispiele). „In practical terms, it means that when you’re learning a new language, you’re not simply learning a new way of talking, you are also inadvertently learning a new way of thinking“ (Boroditsky 2009: 125). Weiterhin hat sich gezeigt, dass Sprecher/innen von Sprachen mit grammatischem Geschlecht ein stärkeres Genderbewusstsein entwickeln, was eine geschlechtsspezifische Voreingenommenheit nach sich zieht, sogar bei nicht belebten Objekten (Sato et al. 2017).
Читать дальше