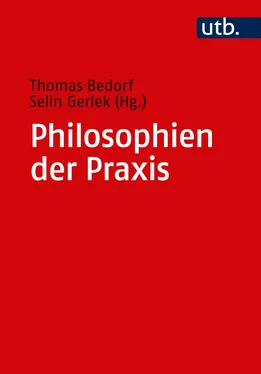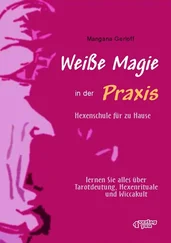3.2. Das Konzept einer praktischen Vernunft
Besondere Bedeutung für das Konzept der Praxis hat somit bei Aristoteles die Annahme einer spezifisch praktischen Form von Rationalität, die er selbst bereits an drei Stellen als „praktische Vernunft“ bezeichnet. Diese Stellen lassen deutlich erkennen, wie sich das aristotelische Konzept praktischer Vernunft von der gleichnamigen Konzeption Immanuel Kants unterscheidet, die vom strikt universalen kategorischen Imperativ geprägt ist. Den Ausdruck „Praktische Vernunft“ gebraucht Aristoteles explizit an folgenden Stellen:
Diese beiden sind also Vermögen der örtlichen Bewegung, Geist und Streben, und zwar der Geist, der um etwas willen nachdenkt und der praktische ( nūs de ho heneka tū logizomenos kai ho praktikos ). Er unterscheidet sich nämlich durch sein Ziel vom theoretischen. Auch jedes Streben erfolgt um etwas willen. Worauf sich nämlich das Streben richtet, dies ist das Prinzip der praktischen Vernunft ( hū gar hē orexis, hautē archē tū praktikū nū ). Das Ende ist aber das Prinzip der Praxis. Folglich werden diese beiden zu Recht für die Anfänge der Bewegung gehalten, Streben und praktische Vernunft ( orexis kai dianoia praktikē ). ( De anima [DA] III 10, 433a13–18)
Dasselbe muss die Vernunfterkenntnis sagen und das Streben verfolgen. Dies ist nun die praktische Vernunft und die entsprechende Wahrheit ( hē dianoia kai hē alētheia praktikē ). Bei der theoretischen und weder praktischen noch poiētischen Vernunft ist das gute und schlechte Funktionieren das Wahre und das Falsche (dies ist nämlich die Funktion jedes Vernunftvermögens). Beim praktischen Vernunftvermögen aber besteht die Wahrheit in Übereinstimmung mit dem richtigen Streben ( NE VI 2, 1139a22–31).
Es gibt Leute, die […] häufig, ohne aufzufallen, der Sache nicht zugehörige und überflüssige Argumente ( logous ) vorbringen. Dies aber tun sie manchmal durch Unwissenheit, manchmal durch Frechheit, und durch sie lassen sich manchmal auch die Erfahrenen und zum Handeln Fähigen täuschen, durch Leute, die architektonische oder praktische Vernunft ( dianoian architektonikēn ē praktikēn ) weder besitzen noch dazu in der Lage sind. ( EE I 6, 1216b40–17a10).
Die ersten beiden dieser drei Stellen stimmen in mehreren wichtigen Punkten überein:
1 Es gibt eine praktische Vernunft, die sich von der theoretischen unterscheidet.
2 Der Unterschied zum theoretischen Denken besteht darin, dass die praktische Vernunft sich auf ein Ziel bezieht. Im richtigen Bezug darauf liegt die ihr eigene Wahrheit.
3 |15|Dies hängt damit zusammen, dass die praktische Vernunft stets mit einem Streben verbunden ist.
Weiterhin sind einige Aspekte erwähnenswert, die zumindest an einer der drei Stellen genannt werden: Die De anima -Stelle weist darauf hin, dass auf einen Akt der praktischen Vernunft unmittelbar Praxis, also ein Handeln, folgt. Die Passage aus der Eudemischen Ethik mit ihrem Hinweis auf ein „architektonisches“, d.h. leitendes, Vermögen, zu dem auch die Klugheit in Verbindung stehen soll, bestätigt, dass es hier um nichts anderes geht als um die eben diskutierte Klugheit, der ebenfalls ein solches architektonisches Vermögen, gemäß ihrer politischen Kompetenz, zugeschrieben wird (vgl. NE VI 8, 1141b21–27; zu Übersetzungsvorschlägen Wolf 2002, 266). Vor diesem Hintergrund weist die Stelle aus Nikomachische Ethik VI auf einen Punkt hin, der für unser Verständnis der Aussage, die Klugheit sei eine Tugend, zentral ist: Nach dieser Stelle ist die Richtigkeit des Strebens ausschlaggebend für die Wahrheit der praktischen Vernunft und wird selbst durch die sogenannte ethische Tugend garantiert.
3.3. Praxis als Zusammenwirken von praktischer Vernunft und Tugend
Damit ist ein weiterer Zentralbegriff der aristotelischen Ethik angesprochen, nämlich der der Tugend, die auch in der aristotelischen Konzeption eine wesentliche Voraussetzung für die Eudaimonie ist ( NE I 6, 1098a 12–18). Denn diese besteht in einer Aktivität gemäß der Tugend, wofür das Besitzen von Tugenden notwendig ist. Bis heute bekannt ist auch Aristoteles’ Lehre der Beschreibung der sogenannten ethischen Tugenden als Haltungen, durch die jemand darauf abzielt, die rechte Mitte in einem Gegenstandsbereich zu treffen, z.B. in der Tapferkeit zwischen Feigheit und Tollkühnheit ( NE II 5f.). In diesen Kontext gehören auch seine Lehren von den Tugenden des sozialen Lebens, vor allem der Gerechtigkeit in Nikomachische Ethik V, aber auch der Freundschaft in Nikomachische Ethik VIII–IX. Da zudem richtige Freude bzw. Lust aus tugendhafter Aktivität entstehen und ein willensschwaches (akratisches) Handeln durch Tugend verhindert werden soll, kann man die Nikomachische Ethik in ihrer Gänze durchaus als eine ausführliche Tugendlehre charakterisieren.
Ein philosophisch exaktes Verständnis von Aristoteles’ Tugendlehre und ihrem Bezug zum Handeln ist jedoch nicht einfach, und das hat nicht zuletzt mit der praktischen Vernunft bzw. Klugheit zu tun: Zwar ist es klar, dass Aristoteles diese im Rahmen seiner Unterscheidung zweier Arten von Tugenden – nämlich „dianoetischer“ Tugenden des Verstandes und „ethischer“ Tugenden des Charakters, die insbesondere ein kontrolliertes Verhältnis zur eigenen Emotionalität bewirken ( NE II 1) – den Verstandestugenden zurechnet. Doch das Verhältnis der Klugheit zu den ethischen Tugenden, das Aristoteles vor allem gegen Ende von Buch VI der Nikomachischen Ethik behandelt, stellt ein zentrales Problem für |16|die Interpretation der aristotelischen Ethik dar. Denn die Aussagen, die Aristoteles hierzu trifft, klingen zunächst einmal kontraintuitiv:
Das Werk wird gemäß der Klugheit und der ethischen Tugend ausgeführt; denn die Tugend macht das Ziel richtig, die Klugheit das auf dieses Hinführende. (NE VI 12, 1144a6–8)
Die Tugend bzw. Schlechtigkeit verdirbt das Prinzip bzw. rettet es; in den Handlungen ist das Worumwillen Prinzip, so wie in der Mathematik die Hypothesen. Weder dort lehrt also die Vernunft die Prinzipien, noch hier, sondern die entweder natürliche oder angewöhnte Tugend lehrt die richtige Meinung über das Prinzip. ( NE VI 9, 1151b15–19)
Für den tugendhaften Menschen scheint dies zu bedeuten, dass die Richtigkeit seiner Ziele nicht durch die Klugheit oder durch eine andere Form von Vernunft sichergestellt ist, sondern allein durch die ethische Tugend, d.h. durch sein gutes Ethos bzw. seinen guten Charakter. Diese Ansicht stimmt auch mit den aus De anima III 9–10 und Nikomachische Ethik VI 2 zitierten Aussagen sowie der für Aristoteles wichtigen Verbindung von Klugheit und Überlegung ( būleusis ) überein, die stets mit dem Hinweis verbunden ist, dass man nicht über Ziele, sondern über Mittel überlegt (v.a. NE III 5–6). Ferner steht sie in enger Korrespondenz zu Aristoteles’ Lehre von der Vorzugswahl ( prohairesis ), die üblicherweise als Wahl der richtigen Mittel für ein vorliegendes Ziel verstanden wird ( NE III 4). Aristoteles war demnach offensichtlich der Meinung, die Ziele richtigen Handelns seien dem Handelnden durch seine ethische Tugend vorgegeben und nicht durch die praktische Vernunft. Die Praxis erweist sich somit als ein guter Lebensvollzug, in dem die Klugheit im Rahmen eines durch Tugend grundsätzlich geprägten Agierens die Richtung des Tuns im Einzelnen ermittelt. Damit ist der Verstehenshorizont bestimmt, von dem aus die aristotelische Praxisphilosophie seit der Antike gelesen wurde, zum Beispiel von Thomas von Aquin im 13. und auch noch von Julius Walter im 19. Jahrhundert: Sie interpretierten die aristotelische Beschreibung von Praxis und praktischer Vernunft nicht primär als eine Deduktion aus Prinzipien, die die Vernunft selbst aufstellt, sondern als einen Vollzug des bereits tugendhaften Menschen. (Thomas von Aquin, SLE VI, 10, l. 151–162 Gauthier; STh Prima Secundae I-II 57, 5; s. Walter 1873, 74f.)
Читать дальше