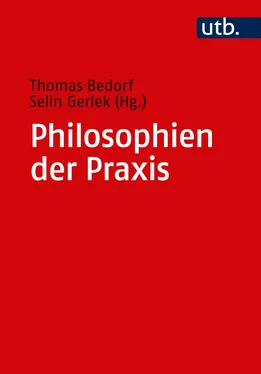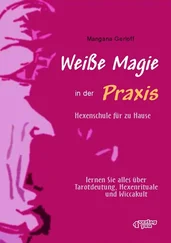Bei allen Unterschieden ist den hier behandelten Philosophien gemeinsam, Praxis als eine Form kollektiven Vollzugs zu verstehen, der sich nicht aus einzelnen zweckgerichteten Handlungen zusammensetzt: Praxis ist prinzipiell offen. In der gegenwärtigen sozial- und kulturwissenschaftlichen Diskussion (s.u.) ist dies wiederholt als Praxis, aber auch (um ihre Pluralität betonen zu können und sie einzeln analysierbar zu machen) als Praktiken bezeichnet worden.
3. Holistischer Anspruch: Wegweisend für diese dritte Variante ist eine Erweiterung der Praxis-Auffassung. Hier fungieren nicht mehr einzelne kulturelle oder soziale Vollzugspraktiken als Analysegegenstand der Theorie, vielmehr steht am Grunde des Ganzen selbst eine Bewegung: das „Leben“, der „Geist“, das „Tätigsein“, die „Geschichte“. Einen wichtigen Einsatz markiert dabei die Philosophie Hegels, die den aristotelischen Begriff der praxis wieder aufgreift, aber vor allem Vernunft selbst in ihrem Vollzug begreift, zu dem ihre Materialisierungen in Sitte, |4|Institution und Recht hinzugehören. Das Auseinandertreten von theoretischer und praktischer Vernunft – wie sie aus der disziplinären Unterscheidung von Theoretischer und Praktischer Philosophie vertraut ist – wird so überführt in eine spannungsreiche Reflexion über das und mit dem Medium, in dem sich ihre Begriffe entfalten. Wenn zum Denken aber auch seine geschichtliche Entfaltung gehört, so ist jedes Nachdenken über das Denken selbst situiert und auf einen Standpunkt bezogen, sodass die nachhegelsche ‚Verwirklichung der Philosophie‘ die politisch verändernde Kraft einer Philosophie der Praxis weit deutlicher in ihr Zentrum zu rücken vermag. Dass erst Marx und an Marx anschließende AutorInnen explizit auf den Begriff der Praxis statt auf den des Geistes (wie bei Hegel selbst) zurückgreifen, lässt nicht daran zweifeln, dass in diesem philosophiehistorischen Kontext der anspruchsvollste Versuch vorliegt, von der Praxis her zu denken. Eine nicht zeitlich parallele, aber sehr wohl dem Gegenstand geschuldete, inhaltlich Analogien bietende Entwicklung lässt sich mit Blick auf spätere Positionen nachzeichnen: Wittgensteins Sprachholismus, dessen Gebrauchstheorie der Sprache Bedeutung von der geteilten Praxis her denkt, wird in der Folge nicht nur von Sprechakttheoretikern wie Austin aufgegriffen, die ihrerseits von der Praxis her zu denken beginnen; ihren konsequentesten Ausdruck findet dieser holistische Anspruch schlussendlich bei den PoststrukturalistInnen, die mit ihrer Stärkung der Performativität die mit Wittgenstein begonnenen Denkfiguren kulturtheoretisch zugespitzt haben.
Konkret verhandelt werden in den in diesem Handbuch zusammengestellten Überblicksartikeln nur das 2. und 3. Verständnis des Ausdrucks „Philosophie der Praxis“, während der disziplinäre Anspruch (die Unterscheidung von Theoretischer und Praktischer Philosophie im herkömmlichen Sinne) selbst als motivationaler Hintergrund fungieren mag. Gemeinsam ist ihnen der Non-Dualismus, der die Praxis wesentlich als performativen Vollzug denkt. Als Performanz ist Praxis nicht reduzibel auf die Bedingungen ihrer Hervorbringung oder die AkteurInnen und Strukturen, die verantwortlich für Form und Inhalt der jeweiligen Praxis sind, sondern ihre Bedeutung liegt in ihr selbst (was eine erläuterungsbedürftige These ist): Jedweder Zugriff auf Praxis lässt die Performanz zunächst einmal ‚erstarren‘, er zeigt daher einen bzw. zeugt von einem jeweiligen Zugriff unter je zu explizierenden Vorzeichen. Philosophien der Praxis machen daher deutlich, dass ein Sprechen über sich vollziehende Praxis zwar einen Gegenstand (bzw. mehrere) thematisiert, diesen (bzw. diese) jedoch als Resultate von Praxis selbst begreift.
Aus der Tatsache, dass sich die Philosophien der Praxis mit ihrer Distanzierung von dichotomischen Grundüberzeugungen zu einer spezifisch neuzeitlichen Konstellation in Beziehung setzen, begründet sich auch die eigentümliche Diskontinuität in der historischen Abfolge der Beiträge. Denn auf den antiken, vornehmlich aristotelischen Praxisbegriff, auf den mehr oder minder alle Praxis-PhilosophInnen Bezug nehmen, folgt nicht etwa eine anhaltende Rezeptions- |5|und Umarbeitungsgeschichte, sondern eine gewisse Stille, in welcher der Begriff seine Anziehungskraft einbüßt. Es ist dann v.a. die Geistphilosophie Hegels und die materialistische Geschichtsphilosophie, die bei den Linkshegelianern ihren Ausgangspunkt nimmt und die den Praxisbegriff wieder auf die Agenda setzt. Das 20. Jahrhundert wiederum kann schließlich als die Blütezeit der Praxiskonzeptionen gelten, wenn im Ausgang von Wittgenstein die Sprechakttheorien und PoststrukturalistInnen oder im Ausgang von Husserl die PhänomenologInnen neuerlich vielgestaltig sich ausnehmende Praxisphilosophieangebote bieten.
In jüngster Zeit erfahren Theorien von „Praxis“ im Zuge der Wendung von den Geistes- zu den Kulturwissenschaften bzw. der Praxiswende in den Sozialwissenschaften selbst vermehrte Aufmerksamkeit und stellen ab auf die Untersuchung vor allem materiell und korporal vermittelter Praktiken sozialer und kultureller (Re-)Produktion. Philosophische Denkströmungen und Positionen v.a. des 20. Jahrhunderts werden seit etwa zwei Jahrzehnten als Ausgangspunkt genommen, um vermittels einer Belehrung über theoretische Engführungen der Vergangenheit jene blinde Flecken der Theorie wieder sichtbar zu machen: der Körper des body turn , der sprachliche Vollzug des linguistic turn und die Dinge des material turn führen heute zu einer breit aufgestellten Programmatik seitens der sogenannten „Praxistheorien“ in den Sozial- und Kulturwissenschaften (für das Stiftungsmoment des sog. practice turn : Schatzki et al.; 2001 Reckwitz 2003 sowie Schäfer 2016; Daniel et al. 2015; Prinz 2014; Hörning/Reuter 2004; Hillebrandt 2009). Der Philosophie bietet diese Entwicklung die Chance, diese Theoriebewegung selbst noch einmal auf ihre philosophischen Wurzeln hin zu befragen (in dieser Sicht, aber auch mit Blick auf eine Renaissance einer Philosophie der Praxis, die mit kultur- und sozialwissenschaftlichen Praxistheorien Gemeinsamkeiten hat, sei etwa verwiesen auf: Alkemeyer et al. 2015; Bedorf et al. 2017; Kertscher et al. 2015).
So sehr die zeitgenössische Konjunktur der „turns“ Neuigkeit suggeriert, so zeigt doch – darin zumindest bestand die Ausgangshypothese zu diesem Handbuch – ein Blick in die Geschichte der Philosophie, dass die Arbeit an der Theorie der Praxis nicht nur so neu nicht ist, sondern v.a. eine Breite philosophischen Problembewusstseins bietet, das wiederum auf die heutige Theoriediskussion rückwirken kann. Gerade aus der philosophiehistorischen Vergewisserung lässt sich ableiten, dass die Bearbeitung der Pluralität der Philosophien der Praxis in ihren Familienähnlichkeiten mehr verspricht als die Hoffnung auf eine kurzfristige Engführung auf die eine Theorie oder Philosophie der Praxis. Daraus, dass das methodische und das holistische Verständnis von „Philosophie der Praxis“ sich darin unterscheiden, welchen Umfang Praxis hat und welche Rolle sie jeweils spielen soll und kann, folgt auch die Notwendigkeit, für den Titel dieses Handbuchs den Plural zu wählen. Er signalisiert die Offenheit in diesem Feld unterschiedlicher Ansätze, die jeweils den Praxisbegriff in den Vordergrund rücken. Denn eine „Praxisphilosophie“ oder eine „Philosophie der Praxis“ gibt es (derzeit) nicht.
|6|Legt man diesen Befund zugrunde, mag es manche/n verwundern, dass ein Handbuch zu einem philosophischen Feld erscheint, das keineswegs als bereits in Standardwissen transformiert gelten kann, sondern vielmehr als offenes Forschungsfeld gelten muss. Aufgrund der Aktualität des Praxisbegriffs einerseits und der reichhaltigen philosophischen Tradition der Reflexion von der Praxis her andererseits, schien es jedoch ebenso legitim wie wünschenswert, diese für die gegenwärtigen Forschungen in der Philosophie und ihren Nachbarwissenschaften zu sichten und verfügbar zu machen. Wenn künftige Forschungen es als überholt erscheinen lassen, hätte sich der Zweck des Handbuchs erfüllt.
Читать дальше