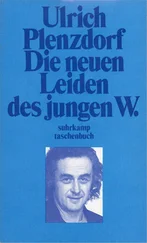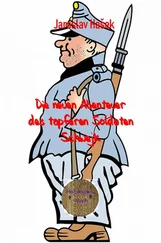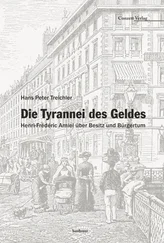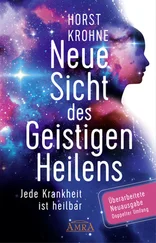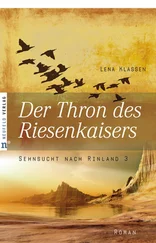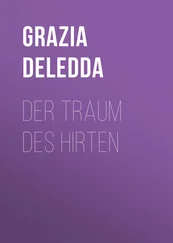Zum einen pointiert das Modell des deontischen Kontoführensdeontische Kontoführung radikal die Gemachtheit und Kritisierbarkeit materialer Inferenzen. Und dies betrifft insbesondere die rechtlichen Normen, denn sie sind stets materiale Inferenzen, sofern sie einen Sachverhalt mit einer Folge verknüpfen. Während die These von der Gemachtheit des Rechts – sieht man allein auf das Resultat – inzwischen womöglich weniger spektakulär ist, lässt sich aus der sanktionalen Macht, die dem einzelnen Akteur im Modell der Kontoführung zukommt, zum anderen auch das Regelungsvakuum erahnen, durch dessen Ausfüllung das Recht überhaupt zu legitimieren ist. Kann nämlich das Einnehmen und Ausführen von normativen Haltungen zu intransparenten und volatilen Inferenzstrukturen oder auch zu invasiven Bewertungs- und Begründungsanforderungen führen, so kommt dem Recht die Funktion zu, allgemeingültige materiale Inferenzen festzuzurren und den Bereich ihrer Anwendung zu begrenzen[402]. Durch das Recht wird für gewisse Handlungsfelder eine einheitliche Perspektive festgelegt, aus der sich allgemeinverbindlich beurteilt, was angemessene Inferenzen, das heißt gute Gründe, sind. Zugleich ist das Recht auch weniger invasiv, indem es nämlich einen Bereich markiert, in dem rechtlich relevante Gründe nur verlangt werden dürfen – und damit umgekehrt bestimmt, wann der Hinweis auf die generelle |101|Handlungsfreiheit weitere Begründung überflüssig macht sowie dadurch zugleich einen Bereich berechtigter Geheimsphären ermöglicht[403].
Neben dieser Leistungsbeschreibung an das Recht, lässt ein anderes Merkmal der Kontostruktur die Grenzen des Rechts erahnen: gemeint ist die erwähnte Vertrauensvorschuss- und Anfechtungsstruktur[404]. Zwar besteht nach dem Modell deontischer Kontoführungdeontische Kontoführung potentiell bei jeder Behauptung – so sie zu weiteren Inferenzen berechtigen soll – die Möglichkeit, nach einer Begründung für das Behauptete zu fragen, das heißt zur Explizierung der angewendeten Inferenzen aufzufordern. Doch stößt diese Modellannahme an Grenzen: Zum einen lässt sich theoretisch in der Art eines antiskeptischen Arguments in Frage stellen, ob das gleichzeitige Bezweifeln jeder Behauptung überhaupt möglich ist. Zum anderen ist es in der sozialen Situation schlicht praktisch unmöglich, alle materialen Inferenzen zu explizieren. Dies hat zur Konsequenz, dass gerade das Modell deontischer Kontoführungdeontische Kontoführung auf Vertrauen angewiesen ist. Für das Recht wird damit die Frage relevant, wie das Vertrauen, eine Person werde sich gemäß den ihr zugeschriebenen Festlegungen verhalten, zu operationalisieren ist[405].
Während BrandomBrandom, Roberts Modell implizit die Frage aufwirft, wann damit gerechnet werden kann, dass sich ein Akteur gemäß seiner Gebundenheit verhält, so lässt sich dem Modell der Kontoführung die Antwortmöglichkeit auf die vorgelagerte Frage entnehmen: Nämlich wie diese Gebundenheit überhaupt entsteht – die Frage nach der Begründung von Normativität. Wie wir sahen, lassen sich für die Schlussfolgerungsakte, über die wir die deontischen Konten führen, Gründe erfragen. Doch enden diese Frageketten in materialen Inferenzen, also solchen Inferenzen, die wir als akzeptierte behandeln. Doch wie ergeben sich solche materialen Inferenzen? Das interessante an BrandomBrandom, Roberts Konzeption liegt hier darin, dass ihm zufolge die ursprüngliche Ressource der Normativität in der sanktionalen Haltung gegenüber einer Performanz zu finden ist. Normative Relevanz gewinnen Verhaltensakte dadurch, dass sie Sanktionen nach sich ziehen. Die minimalste Sanktionseinheit ist dabei, einen Akt als berechtigt bzw. als nicht-berechtigt zu behandeln – und dadurch zu weiteren Akten berechtigend bzw. nicht-berechtigend [406]. Man kann diese Sanktionsstruktur als problematisch ansehen[407], oder aber darin ein Anerkennungs-Moment erkennen, und zwar die Struktur der wechselseitig sanktionsbefähigten Akteure[408]. Tut man dies, lässt sich BrandomBrandom, Roberts Ansatz |102|bezogen auf die Frage der Normativität als proto-sanktionaler Ansatz begreifen. Die Gleichgerichtetheit und Gleichförmigkeit in der Behandlung eines Aktes als berechtigt bzw. nicht-berechtigt ist die Generierung von Normativität. Der Prozess der Normativität hat die Gestalt eines unendlichen Spiegels[409] (»Ich behandle die Performanz als berechtigt und behandle dein Berechtigt-halten für berechtigt usf.«)[410]. In dieser sanktionalen Gleichförmigkeit kommt BrandomBrandom, Robert der klassischen Form der Koordinierung künftigen Verhaltens äußerst nahe, nämlich der Form des Vertrages . Man kann sogar so weit gehen, seinen Ansatz als proto-kontraktualistisches Programm zu rekonstruieren[411]. Gegenüber herkömmlichen Kontraktualismen besteht ein Vorzug seines Modell darin, dass die sanktionale Struktur bereits an proto-kooperative Verhältnisse[412] anknüpfen kann: Sie muss nicht auf eine (konkludente) vertragliche Vereinbarung warten, sondern kann bereits mit dem Handeln (prattein) beginnen, einem Handeln, das im Bewusstsein der sanktional-anerkennenden Beobachtung durch den anderen Akteur vollzogen wird. Dadurch ergibt sich die universelle Struktur, die den Anderen im Anerkennen anerkennt.
Bertram , Georg W. , Die Sprache und das Ganze, Weilerswist 2006.
Brandom , Robert B. , Making it Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment, Cambridge, Mass. 1994 (= Expressive Vernunft. Begründung, Repräsentation und diskursive Festlegung, übers. v. Eva Gilmer und Hermann Vetter, Frankfurt am Main 2000).
ders. , Between Saying and Doing: Towards an Analytic Pragmatism, Oxford 2008.
ders. , Wiedererinnerter Idealismus, übers. v. Falk Hamann und Aaron Shoichet, Berlin 2015.
Davidson , Donald , Handlung und Ereignis, Frankfurt am Main 1985.
ders. , Wahrheit und InterpretationInterpretation, Frankfurt am Main 1986.
ders. , Subjektiv, intersubjektiv, objektiv, Frankfurt am Main 2004.
Detel , Wolfgang , Grundkurs Philosophie Bd. 3: Philosophie des Geistes und der Sprache, Stuttgart 2007.
Glüer , Kathrin , Donald Davidson zur Einführung, Hamburg 1993.
Knell , Sebastian , Propositionaler Gehalt und diskursive Kontoführung. Eine Untersuchung zur Begründung der Sprachabhängigkeit intentionaler Zustände bei Brandom, Berlin/New York 2004.
Lepore , Ernest (Hrsg.), Truth und InterpretationInterpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, New York 1986.
|103| Lepore , Ernest / Ludwig , Kirk (Hrsg.), A Companion to Donald Davidson, Oxford 2013.
Liptow , Jasper , Regel und InterpretationInterpretation. Eine Untersuchung zur sozialen Struktur sprachlicher Praxis, Weilerswist 2004.
ders. , InterpretationInterpretation, Interaktion und die soziale Struktur sprachlicher Praxis, in: Bertram, Georg W./Liptow, Jasper (Hrsg.), HolismusHolismus in der Philosophie. Ein zentrales Motiv der Gegenwartsphilosophie, Weilerswist 2002, 129–146.
Müller , Friedrich / Christensen , Ralph , Juristische Methodik, 11. Aufl., Berlin 2013.
Malpas , Jeff (Hrsg.), Dialogues with Davidson. Acting, Interpreting, Understanding, Cambridge, Mass. 2011.
Picardi , Eva / Schulte , Joachim , Die Wahrheit der Interpretation. Beiträge zur Philosophie Donald Davidsons, Frankfurt am Main 1990.
Ramberg , Björn T. , Donald Davidson’s Philosophy of Language. An Introduction, New York 1989.
Читать дальше