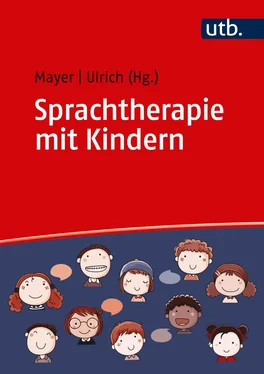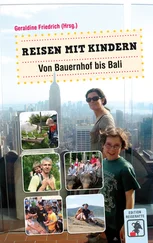Schließlich wünschen wir uns, dass das vorliegende Lehrbuch Studierende der Sprachtherapie und der Sprachheilpädagogik in ihrer Ausbildung unterstützt, dass Sprachheilpädagogen und Sprachtherapeuten Anregungen für ihre anspruchsvolle praktische Tätigkeit und Lehrende an Fachhochschulen und Universitäten Impulse für die Lehre und Forschung erhalten.
Aufgrund der leichteren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen in diesem Lehrbuch die männliche Form verwendet. Doch es sind selbstverständlich Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler etc. gemeint. Beide Geschlechter sind immer mitzudenken.
Februar 2017 Tanja Ulrich, Andreas Mayer
Aussprachestörungen
Von Annette Fox-Boyer und Sandra Neumann
1 Die ungestörte Entwicklung
Kinder erwerben das Lautsystem ihrer Muttersprache in der Regel ohne Schwierigkeiten während der ersten Lebensjahre. Ab dem Alter von drei Jahren hat ein monolingual deutschsprachiges Kind alle Grundlagen der Aussprache erworben. Es ist auch für Fremde verständlich und benötigt noch maximal zwei Jahre, um seine Aussprache zu perfektionieren.
1.1 Begriffsklärungen

Unter einem Phon versteht man laut Crystal (1997) das kleinste wahrnehmbare diskrete Laut- / Geräusch-Segment, das innerhalb des Sprechstroms wahrnehmbar ist.
Es ist also ein Sprachlaut, der unabhängig von seiner sprachlichen Umgebung, isoliert von einem Menschen gebildet werden kann. Ein Kind muss lernen, welche Laute von all denen, die es produzieren kann, seiner Sprache angehören (Phoninventar). Gleichzeitig muss es auch lernen, diese alle korrekt zu produzieren. Phone werden in eckigen Klammern notiert, z. B. [s].

Als Phonem wird eine bedeutungsunterscheidende sprachliche Einheit definiert, die sich nicht weiter in bedeutungsunterscheidende Einheiten zerlegen lässt.
Es handelt sich um abstrakte, im phonologischen Lexikon gespeicherte Einheiten. Phoneme sind Phone, die von einem Kind im Sprechfluss an korrekter Stelle eingesetzt werden. Das Kind muss während des Ausspracheerwerbs lernen, wie Phone in seiner Muttersprache miteinander verbunden werden dürfen (Phonotaktik) und dass es von Bedeutung ist, den richtigen Laut an der vorgesehenen Stelle zu verwenden, da es sonst zu Bedeutungsveränderungen kommen kann (Erwerb des phonemischen Inventars). In den meisten Fällen wird ein Phonem im Deutschen durch ein Phon repräsentiert. In Ausnahmefällen kann ein Phonem auch durch verschiedene Phone repräsentiert werden, wie dies zum Beispiel bei den Phonen [ç] und [x] der Fall ist. Diese Phone teilen sich eine Bedeutung. Phoneme werden zwischen Schrägstrichen notiert, z. B. / f / .

Allophone sind unterschiedliche Realisationsmöglichkeiten eines Phonems, deren Realisation nicht zu einer Bedeutungsveränderung führt.
So verändert es im Deutschen nicht die Bedeutung eines Wortes, wenn ein Kind für ein / ʁ / ein [r] artikuliert.

Phonotaktik ist die Lehre von der Reihenfolge bzw. Kombinierbarkeit von Phonemen in einer Sprache.
phonotaktische Regeln Die Abfolge von Phonemen im Deutschen ist nicht beliebig, sondern ist phonotaktischen Regeln unterworfen. Typische Silbenstrukturen sind laut Wiese (1996) Konsonant-Vokal-Folgen (CV), CVC-Folgen oder CCVC-Folgen.

Das phonetische Inventar umfasst diejenigen Laute (Phone), die ein Kind artikulatorisch realisieren kann, unabhängig davon, ob sie (schon) korrekt im Wort verwendet werden. Das phonemische Inventar eines Kindes umfasst diejenigen Phoneme, die ein Kind an richtiger Stelle im Wort verwendet. Diese müssen nicht notwendigerweise phonetisch korrekt sein.
Laut Fox-Boyer (2016) kann ein Phonem als erworben angesehen werden, wenn ein Kind ein Phonem in mindestens zwei Drittel aller Auftretensfälle richtig im Wort einsetzt. Kinder erwerben ihre Muttersprache in den ersten Lebensjahren in der Regel ohne große Anstrengung, eher spielerisch. Dabei erscheinen die Lall-Äußerungen des Kindes für Eltern als erster Hinweis auf den beginnenden Spracherwerb. Zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr kommt es zu einem fließenden Übergang von nicht-lexikalischen und lexikalischen sprachlichen Äußerungen.
Zu den nicht-lexikalischen Äußerungen zählen alle Äußerungen des Lallens, die nicht mit einer Bedeutung unterlegt sind. Im Gegensatz dazu stehen die ersten Wörter, die in ihrer Form nicht notwendigerweise der Erwachsenensprache entsprechen. Scheinbar ohne Schwierigkeiten gelingt es den Kindern, die vielleicht zunächst rudimentären Wortformen immer mehr der Erwachsenensprache anzugleichen, bis sie in Bezug auf die Aussprache als erwachsenenartig zu beschreiben sind. Im Hinblick auf die expressive Sprachentwicklung geht die phonetische Entwicklung der phonologischen Entwicklung des Lautsystems voraus. Die Kinder produzieren also zunächst Phone und später erst beim Übergang in die lexikalischen Äußerungen Phoneme.
Phonologieerwerb Der Phonologieerwerb kann aus klinischer Sicht in vier Stufen unterteilt werden:
■ die verschiedenen Phasen des Lallens,
■ die Einwortphase vom ersten Wort bis zum Wortschatzspurt,
■ die systematische Simplifizierungsphase und
■ die korrekte Wortrealisation (Stackhouse / Wells 1997).
Kinder müssen die phonologischen Regeln ihrer Muttersprache erwerben, d. h., sie müssen verstehen, welche Laute in welchem Silbenkontext angewendet werden dürfen. Des Weiteren müssen sie die komplexe Silbenstruktur des Deutschen (die Phonotaktik) erwerben.
1.2 Frühe rezeptive phonetisch-phonologische Entwicklung (0 bis 12 Monate)
Kinder zeigen bereits vor der Geburt wichtige phonetisch-phonologische Perzeptionsleistungen, die sich kontinuierlich weiterentwickeln und die spätere phonologische expressive Entwicklung entscheidend beeinflussen (Fox-Boyer / Schäfer 2015). In die Sprachperzeption und Analyse des Inputs spielen nicht-linguistische, allgemein kognitive Leistungen ebenfalls mit hinein (Kauschke 2012).
Um sich auf spezifisch muttersprachliche Signale fokussieren zu können und diese phonetisch-phonologisch zu erwerben, müssen Kinder nicht-sprachrelevante Informationen oder nicht-muttersprachlichen phonetischen Input ausblenden (Conboy et al. 2008). Da im fünften bis siebten Schwangerschaftsmonat die Hörentwicklung von Ungeborenen beginnt, können sie ab diesem Zeitpunkt schon auf Töne und Laute der Außenwelt reagieren, was Groome et al. (2000) anhand von Vokalwahrnehmungen belegen konnte. Die Ungeborenen erkennen dann auch schon rhythmische und prosodische Veränderungen am sprachliche Input.
Nach Byers-Heinlein et al. (2010) prägen sich durch diese pränatale Wahrnehmung der Umgebungssprache Perzeptionspräferenzen aus, die schon direkt beim Neugeborenen (z. B. mittels Saugfrequenzmessungen) zu beobachten sind. Bei bilingualen Kindern beginnt sich die Sprachperzeption bereits pränatal auf beide Muttersprachen auszurichten (Burns et al. 2007). Muttersprachliche Vokale können von Babys von prototypischen Vokalen einer Fremdsprache abgegrenzt werden. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass Kinder in den ersten Lebensmonaten auch phonetische Kontraste wahrnehmen können, die nicht in ihrer Muttersprache auftreten. Diese Fähigkeit verringert sich schon zwischen dem sechsten und zwölften Lebensmonat wieder, da sich die Sprachperzeption zunehmend auf die Umgebungs- bzw. Muttersprache ausrichtet (Rivera-Gaxiola et al. 2012). Durch den ständigen Kontakt zur Muttersprache werden deren phonetische Merkmale und Kontraste zunehmend besser erkannt, selektiert und gespeichert (Fox-Boyer / Schäfer 2015). Anhand der Entwicklung allgemein kognitiver und auditiver Wahrnehmungsprozesse beim Kleinkind verbessert sich auch dessen Sprachperzeption ab dem sechsten Lebensmonat deutlich (Kuhl et al. 2006). Die ausschließliche Wahrnehmung von sprachspezifischen Vokalen aus der Umgebungssprache bildet sich um den sechsten Lebensmonat und die der Konsonanten um den elften Lebensmonat aus.
Читать дальше