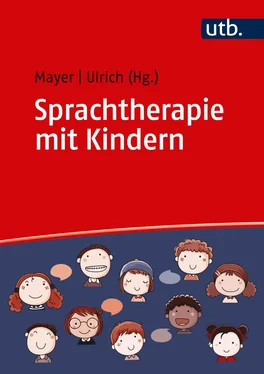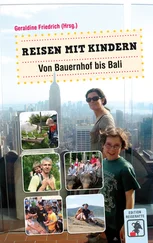2.3 Morphologische und syntaktische Störungen
2.3.1 Morphologische Störungen
2.3.2 Syntaktische Störungen
2.4 Bedingungshintergrund
3 Diagnostik
3.1 Förderdiagnostik
3.2 Diagnostische Methoden
3.3 Allgemeine Sprachentwicklungstests
3.4 Rezeptive Verfahren
3.4.1 Bildauswahlverfahren
3.4.2 Manipulationsaufgaben
3.4.3 W-Fragen
3.5 Informelle Verfahren
3.5.1 Einzelscreenings
3.5.2 Gruppenscreenings
3.6 ESGRAF 4-8
3.7 Diagnose grammatischer Störungen bei Mehrsprachigkeit
4 Therapie
4.1 Notwendigkeit therapeutischer Interventionen
4.2 Evidenzbasierte Grammatiktherapie
4.3 Therapiesettings
4.4 Therapieplanung
4.5 Therapiemethoden
4.5.1 Methodenvielfalt – Methodenintegration
4.5.2 Direkte Übungsmethoden
4.5.3 Indirekte Methoden
4.6 Therapiekonzepte
4.7 Kontextoptimierung
4.7.1 Therapiedidaktik
4.7.2 Prinzipien der Kontextoptimierung
4.8 Grammatiktherapie im Kontext von Mehrsprachigkeit
5 Unterricht
5.1 Grammatikprojekte
5.2 Auswahl eines Grammatikprojekts
5.3 Aufbaukriterien eines Grammatikprojekts
Pragmatische Störungen
Von Stephan Sallat und Markus Spreer
1 Die Entwicklung pragmatischkommunikativer Fähigkeiten
1.1 Begriffsklärung
1.2 Bedeutung von Basiskompetenzen
1.3 Entwicklung non- und paraverbaler Dimensionen
1.4 Entwicklung sprachlicher Dimensionen
2 Störungen im Erwerbsprozess – Symptomatik des Störungsbildes
2.1 Störungen der Entwicklungsperiode
2.2 Störungen der älteren Kindheit und des Jugendalters (7 bis 18 Jahre)
3 Diagnostik
3.1 Überprüfung kommunikativ-pragmatischer Fähigkeiten
3.1.1 Diagnostische Verfahren für den Altersbereich bis 3 Jahre
3.1.2 Diagnostische Verfahren für Kinder im Kindergartenalter (3 bis 6 Jahre)
3.1.3 Diagnostische Verfahren für Kinder im Schulalter
3.1.4 Beobachtungsbögen und Einschätzskalen zur Erfassung der Erzählfähigkeit
3.2 Spezifische Herausforderungen in der diagnostischen Arbeit
4 Therapie
4.1 Erkenntnisse der Therapieforschung
4.2 Grundlegende Vorgehensweisen
4.3 Förder- und Therapiemethoden
4.3.1 Variation der Komplexität von Förderkontexten
4.3.2 Bedeutung des Kommunikationsrahmens sowie der Beziehung und Interaktion zwischen Kind und Therapeut
4.3.3 Verhaltensmodifikation
4.3.4 Formate des Kindes
4.3.5 Verhaltens- und Sozialtrainings
4.3.6 Metasprachliche Reflexion und Diskussion
4.3.7 Einbeziehung der Bezugspersonen
4.4 Therapieableitung – Förderplanung
4.5 Therapie- und Förderschwerpunkte
4.5.1 Kommunikationsverhalten und Gesprächsführung
4.5.2 Textverarbeitung und -produktion
4.5.3 Situations- und Kontextverhalten
5 Möglichkeiten der unterrichtsintegrierten Förderung
5.1 Inhaltliche, soziale, räumliche, sprachliche und kognitive Kontexte in der Schule
5.2 Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten als Teil der Lehr- und Bildungspläne
5.3 Analyse des Unterrichts in Bezug auf pragmatische Herausforderungen
5.4 Therapie- und Förderbereiche in Unterricht und Schule
5.4.1 Kommunikationsverhalten und Gesprächsführung
5.4.2 Textverarbeitung und -produktion
5.4.3 Situations- und Kontextverhalten
5.5 Schule ist mehr als Unterricht
Schriftspracherwerbsstörungen
Von Andreas Mayer
1 Der ungestörte Schriftspracherwerb
2 Störungen im Erwerbsprozess
2.1 Definition
2.2 Ursachen der Lese-Rechtschreibstörung
2.3 Risikofaktoren
2.3.1 Beeinträchtigungen in der phonologischen Informationsverarbeitung
2.3.2 Spracherwerbsstörungen als Risikofaktor
2.4 Symptomatik
2.5 Mögliche Auswirkungen
3 Diagnostik
3.1 Früherkennung
3.2 Diagnostik des Lesens und Rechtschreibens
4 Therapie
4.1 Therapie der Lesestörung
4.2 Therapie der Rechtschreibstörung
5 Unterricht
5.1 Ewerb der GPK
5.2 Unterstützung beim Erlernen der indirekten Lesestrategie
5.3 Vermittlung von Verstehensstrategien
Stottern
Von Patricia Sandrieser
1 Die ungestörte Entwicklung
2 Störungsbild Stottern
2.1 Kernsymptome
2.2 Begleitsymptome: Flucht- und Vermeidungsstrategien
2.3 Häufigkeit, Komorbiditäten und Remissionschancen
2.4 Genetik
2.5 Neuromorphologische Veränderungen und neurofunktionelle Befunde
3 Diagnostik
3.1 Anamnese
3.2 Spontansprachprobe
3.3 Diagnostik der Begleitsymptome und der psychischen Reaktionen auf das Stottern
3.3.1 QBS – Qualitative Beschreibung von Stotterverhalten
3.3.2 RSU – Reaktion auf Stottern des Untersuchers
3.4 Befund und Nomenklatur
4 Beratung und Therapie
4.1 Beratung
4.2 Therapie
4.2.1 Therapieziele
4.2.2 Anforderungen an eine Therapie
4.2.3 Therapieerfolge und -dauer
4.3 Therapiekonzepte
4.3.1 Operante Verfahren
4.3.2 Konzepte zur Modifikation des Stotterns
4.3.3 Konzepte der Sprechrestrukturierung / Fluency Shaping
4.3.4 Kombinationstherapien
4.3.5 Indirekte Verfahren
4.3.6 Obsolete Verfahren
4.4 Abwägung des Therapiekonzepts und -settings
5 Unterricht
Poltern
Von Dana-Kristin Marks
1 Sprachproduktion im Überblick
2 Poltern als Störungsbild
2.1 Der Versuch einer Begriffsbestimmung
2.2 Symptomatik
2.2.1 Erhöhtes und / oder unregelmäßiges Sprechtempo als Ausgangspunkt
2.2.2 Inadäquate Pausensetzung und prosodische Auffälligkeiten
2.2.3 Phonetisch-temporale Auffälligkeiten auf Wortebene
2.2.4 Erhöhte Rate normaler Unflüssigkeiten
2.2.5 Weitere Auffälligkeiten
2.2.6 Mögliche Störungsprofile bei Poltern
2.3 Komorbiditäten
2.4 Diskussion einer „Polterpersönlichkeit“
2.5 Mögliche Bedingungshintergründe
2.6 Prävalenz und Prognose
3 Diagnostik
3.1 Diagnostisches Vorgehen
3.1.1 Ziele, Methoden und Inhalte im Überblick
3.1.2 Überblick über den Ablauf des diagnostischen Vorgehens bei Verdacht auf Poltern
3.2 Berücksichtigung der ICF (WHO 2007) im Diagnostikprozess
4 Therapie
4.1 Therapieziele und -prinzipien
4.2 Therapeutische Konzepte und Methoden
4.2.1 Überblick über aktuelle Therapiekonzepte
4.2.2 Übungen zur Verbesserung der Selbst- und Symptomwahrnehmung
4.2.3 Übungen zur Behandlung der Kernsymptomatik
4.2.4 Übungen für weitere Behandlungsbereiche
5 Unterricht
5.1 Klassenklima
5.2 Unterstützung in ausgewählten Förderbereichen
Mutismus
Von Kerstin Bahrfeck, Katja Subellok und Anja Starke
1 Phänomen Mutismus
1.1 Erscheinungsbild
1.2 Entstehung und Risikofaktoren
1.2.1 Genetische Prädisposition
1.2.2 Familiäres Lernumfeld
1.2.3 Migration und Mehrsprachigkeit
1.2.4 Sprachliche Entwicklung
1.2.5 Einschneidende Lebensereignisse
1.3 Verlauf und Prognose
2 Diagnostik
2.1 Ziele
2.1.1 Identifikation von SM
2.1.2 Erfassen des individuellen Erscheinungsbildes
2.1.3 Verlaufsdiagnostik
2.2 Methoden und Vorgehensweisen
2.2.1 Beobachtung
2.2.2 Gespräche
2.2.3 Frage- und Einschätzungsbögen
2.3 Zusammenfassung und Entscheidungen
3 Therapie
3.1 Methodenkombiniertes Vorgehen
3.2 Wirksamkeit von Mutismustherapie
3.3 Sprachtherapeutische Konzepte
3.3.1 Systemische Mutismus-Therapie (SYMUT)
3.3.2 Therapieansatz nach Katz-Bernstein und Dortmunder Mutismus-Therapie (DortMuT)
3.3.3 Kooperative Mutismus-Therapie (KoMut)
3.4 Grenzen der Sprachtherapie
4.1 Schweigen erkennen, verstehen und gemeinsam handeln
Читать дальше