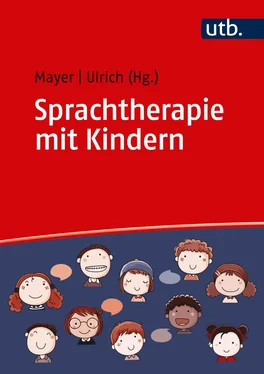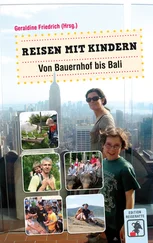4.1 Motorisch orientierte Therapieansätze
Zielgruppe Zielgruppe für die klassische Artikulationstherapie stellen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer phonetischen bzw. Artikulationsstörung da. Die Therapie einer Artikulationsstörung beginnt sinnvollerweise frühestens im Alter von fünf Jahren, da die aktive Mitarbeit der Kinder und Eltern unabdingbar für das Gelingen der Behandlung ist. Jüngere Kinder haben in der Regel zu wenig Störungsbewusstsein und Interesse an der Überwindung der Symptomatik. Ein weiteres Kriterium ist, dass die Behandlung erst nach dem erfolgreichen Zahnwechsel der Schneidezähne stattfinden sollte, was ab ca. sieben Jahren der Fall ist. Die Artikulationstherapie kann allerdings auch bei Erwachsenen wirksam angewendet werden, da sie maßgeblich von der Motivation des Klienten abhängig ist.
Zielsetzung Die Zielstellung der Artikulationstherapie ist die zu 100 % korrekte Realisation der betroffenen Phone, isoliert und in jeglichem linguistischen Kontext, vor allem aber in der Spontansprache.
Therapie nach Van Riper Die klassische Artikulationstherapie wurde von Van Riper zuerst 1939 beschrieben (Van Riper 1939, Van Riper / Irwin 1953). Sie hat ihre Wurzeln in der bis in die 1970er Jahre hinein vertretenen Annahme, kindliche Aussprachestörungen seien in erster Linie Störungen der Artikulation (Elbert 1997). Nach damaliger Auffassung handelte es sich um ein eher peripheres motorisches Problem. Man vermutete, der Aussprachestörung lägen entweder eine sprechmotorische Ungeschicklichkeit zugrunde, welche letztlich auf eine verzögerte neuronale Reifung zurückgeführt wurde, oder Defizite in der auditiven Wahrnehmung von Sprachlauten. Van Riper und Emerick (1984) fassten den Ansatz folgendermaßen zusammen:
„Die traditionelle Artikulationstherapie kennzeichnet sich durch die Abfolge von folgenden Aktivitäten: (1) sensorisch-perzeptives (Hör-)Training zur Identifikation des Standardlautes und dessen Diskrimination von der Fehlproduktion durch das Beobachten (scanning) und das Vergleichen; (2) Variation und Korrektur der verschiedenen Produktionen des Lautes, bis dieser korrekt produziert werden kann; (3) Stärkung und Stabilisierung der korrekten Produktion; und (4) schließlich Transfer der neuen artikulatorischen Kompetenzen in die Alltagskommunikation. Dieser Prozess wird normalerweise zunächst auf der isolierten Lautebene begonnen, dann auf der Silben- (CV, VC, CVC), Wort- und schließlich der Satzebene durchgeführt“ (Van Riper / Emerick 1984, 206).
Hörtraining Im Rahmen des Hörtrainings (auditory bombardment) soll das Kind in die Lage versetzt werden, ein Zielphon in jeglichem noch so minimalen Kontrast zu erkennen. Dem Kind werden zunächst einzelne Phone vorgesprochen und es soll entscheiden, ob es sich bei dem jeweiligen Phon um das Zielphon handelt. Dabei wird zunächst in großer Opposition gearbeitet, was bedeutet, dass das Zielphon in Kontrast zu einem möglichst unterschiedlichen Phon (Unterscheidung in den drei Merkmalen Artikulationsort, Artikulationsart, Stimme) erkannt werden soll (z. B. Zielphon: / s / ; große Opposition: / k / , / l / oder Vokale). Gelingt dies dem Kind, so wird in kleinerer Opposition gearbeitet, was bedeutet, dass sich Zielphon und Kontrastphon nur in zwei Merkmalen unterscheiden (z. B. Zielphon: / s / ; mittlere Opposition: / f / ). Der kleinste Oppositionskontrast bedeutet, dass sich Zielphon und Kontrastphon nur noch in einem Merkmal unterscheiden (z. B. Zielphon: / s / ; minimale Opposition: / z / , / θ / ). Diese Oppositionshierarchie wird auf jeder linguistischen Ebene, dem isolierten Laut, der Silbenebene (CV-Abfolgen), der Wort-, Satz- und Textebene eingehalten.
Van Riper / Emerick (1984) und andere Autoren (z. B. Winitz 1975) sprechen sich dafür aus, das Hörtraining immer der Lautproduktion vorausgehen zu lassen. Dies bestätigten Wolfe et al. (2003), indem sie ein reines Produktionstraining mit einer Kombination aus Produktions- und Hörtraining bei Kindern verglichen, die vor der Behandlung Schwierigkeiten hatten, die Ziellaute korrekt zu identifizieren: Sie konnten zeigen, dass die Effekte bei der kombinierten Behandlung größer waren. Dennoch sollte diese Form des Trainings nur durchgeführt werden, wenn wirklich ein rezeptives Problem vorliegt (Bernthal et al. 2013).
Lautanbahnung Der Schwerpunkt der Artikulationstherapie liegt auf dem expressiven Training. Hierbei wird das fehlgebildete Phon zunächst isoliert stimuliert (Vormachen, Aufforderung zur Nachahmung) und, wenn dies nicht gelingt, phonetisch korrekt angebahnt. Als Unterstützung zur Lautanbahnung können der Bewegungsablauf beschrieben werden, Vorstellungsbilder eingesetzt werden (z. B. bildliche Lautdarstellungen, Ruß 2008), der Laut von einem benachbarten Laut aus abgeleitet werden, ein Spiegel als visuelle Unterstützung, Eis als taktil-kinästhetische Unterstützung verwendet oder grob- und feinmotorische Bewegungen als Hilfestellung angeboten werden (Weinrich / Zehner 2011). In der Lautanbahnung gibt es unterschiedliche Feedback-Methoden:
■ über den kognitiven Kanal: Dem Kind wird erklärt, wie man den Laut bilden kann.
■ über den taktil-kinästhetischen Kanal: Mit Eis oder Wattestäbchen wird dem Kind die korrekte Zungenposition für einen Laut vermittelt. Es kann auch ein ähnlicher Laut (von Artikulationsort oder -art) verwendet werden, von dem der Ziellaut abgeleitet wird.
■ über den visuellen Kanal: Das Kind soll beim Therapeuten schauen, wie dieser den Laut produziert und was man dabei sehen kann. Das Kind kann mithilfe des Spiegels die eigene Zungen- / Lippenstellung beobachten und korrigieren.
■ über Lautunterstützende Bewegungen: Bewegungen, die mit dem ganzen Körper, mit den Händen / Armen oder den Füßen ausgeführt werden, können eine richtungsunterstützende Wirkung auf die Lautproduktion haben (Bewegungsunterstützte Lautanbahnung / BULA, Weinrich / Zehner 2011).
Stabilisierung der Lautbildung Kann das Kind den angebahnten Laut isoliert phonetisch korrekt bilden, so beginnt die Stabilisierungsphase. Der Laut wird nun in einem Übungsdrill zunächst auf Silbenebene trainiert.

Unter der Silbenebene versteht Van Riper die Produktion von CV, VC und VCV Kombinationen (1939, 1963).
Anschließend wird der Laut auf Realwortebene – zunächst in der Regel im Wortanlaut – geübt. Es folgt die Übung auf Satzebene, dann auf Textebene (Gedichte, Reime etc.) und schließlich in der Spontansprache. In der klassischen Artikulationstherapie wird sowohl bei den Hörübungen als auch beim Artikulationstraining immer nur ein Laut zur gleichen Zeit erarbeitet.
mundmotorische Übungen Bei Bedarf werden unterstützend zur Lautanbahnung mund- und zungenmotorische Übungen eingesetzt. Der Begriff Mundmotorik wird in Deutschland sehr global und uneinheitlich genutzt. Zum einen wird er im Bereich der Therapie orofazialer Störungen verwendet, zum anderen in Bezug auf ein generelles „mundmotorisches“ Training bei Aussprachestörungen oder im Hinblick auf ein Wahrnehmungstraining für Lautproduktionsstellen im Mundraum. Teilweise versteht man unter ihm auch eine spezifische Produktionsvorbereitung für einzelne Laute. Daher ist es wichtig, diesen Begriff genauer zu definieren. Lippen- und Zungenübungen zur Behandlung orofazialer Störungen finden sich in Kittel (2014). Wenn eine orofaziale Störung gleichzeitig mit einer Artikulationsstörung (phonetischen Störung) einhergeht, sollte erst mit der Lautanbahnung begonnen werden, wenn die muskulären Voraussetzungen gegeben sind, d. h. parallel zu den Ansaugübungen (Kittel 2014). Globale mundmotorische Übungen bei Vorliegen einer Aussprachestörung oder auch phonetischer Störung haben sich als nicht sinnvoll herausgestellt. Übungen, die den Bewegungsablauf oder die Bewegungsrichtung eines Ziellautes vorbereiten, können der Lautanbahnung dienen. Gegebenenfalls kann hier auf Übungen aus der orofazialen Therapie zurückgegriffen werden. Auch können Wahrnehmungsübungen (z. B. mithilfe von Eiswasser) dem Kind einen bestimmten Artikulationsort verdeutlichen. In diesem Fall handelt es sich aber nicht um eine motorische Übung, sondern eine taktil-kinästhetische.
Читать дальше