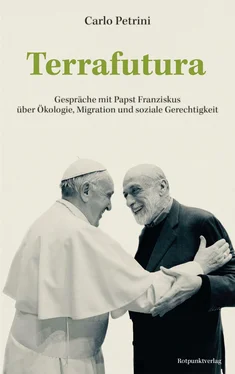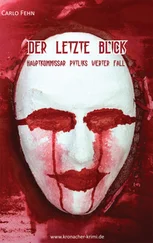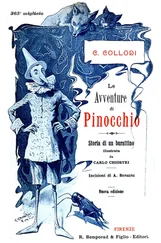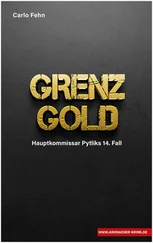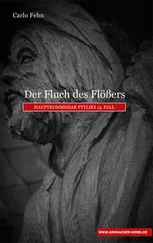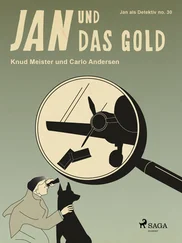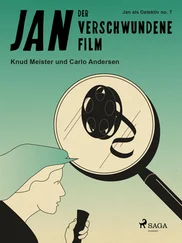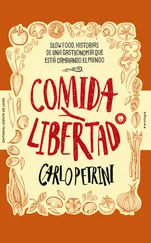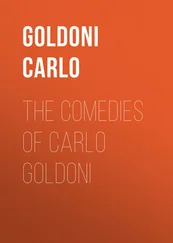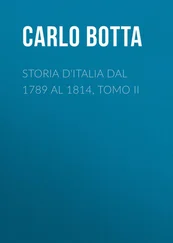1Vgl. Max Weber, Die protestantische Ethik und der »Geist« des Kapitalismus , in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik , 20 und 21, 1904 und 1905.
2»Seit Francis Bacon und René Descartes heißt erkennen beherrschen: Ich will die Natur draußen erkennen, um sie zu beherrschen. Ich will sie beherrschen, um sie mir anzueignen. Ich will sie mir aneignen, um mit meinem Besitz zu machen, was ich will. Das ist ein Denken mit der greifenden Hand: begreifen – auf den Begriff bringen – im Griff haben. Die Vernunft der modernen ›wissenschaftlich-technisch‹ genannten Zivilisation wird nicht mehr als ein vernehmendes Organ, sondern als Instrument der Macht aufgefasst. Die naturwissenschaftlich geprägte Vernunft der modernen Welt sieht nach Immanuel Kant, der Newtons Weltbild philosophisch rationalisierte, ›nur das ein, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt. […] Sie geht mit ihren Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen voran und muss die Natur nötigen, auf ihre Fragen zu antworten‹. Die menschliche Vernunft verhält sich zur Natur wie ein Richter, der die Zeugen ins Kreuzverhör nimmt. Das Experiment ist nach Francis Bacon die Folter, der die Natur unterworfen wird, um auf die Fragen der Menschen zu antworten und ihre Geheimnisse preiszugeben.« Jürgen Moltmann, Gott im Projekt der modernen Welt. Beiträge zur öffentlichen Relevanz der Theologie , Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1997, S. 129 f.
1Vgl. René Descartes, Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs , Reclam, Stuttgart 1995, S. 58.
2Vgl. Antonio Autiero, »Esiste un’etica ambientale?«, in: Matteo Mascia und Renzo Pegoraro (Hg.), Da Basilea a Graz. Il movimento ecumenico e la salvaguardia del creato , Gregoriana Libreria Editrice, Padua 1998, S. 3–30.
1»Damit ist nachgewiesen, dass sich die Entwicklung, wenn sie auch eine notwendige wirtschaftliche Dimension besitzt, weil sie ja der größtmöglichen Zahl der Erdenbewohner die zum ›Sein‹ unerlässlichen Güter zur Verfügung stellen muss, dennoch nicht in dieser Dimension erschöpft. Wenn sie auf diese beschränkt wird, wendet sie sich gegen diejenigen, die man damit fördern möchte. Die Merkmale einer umfassenden, ›menschlicheren‹ Entwicklung, die imstande ist – ohne die wirtschaftlichen Erfordernisse zu leugnen –, sich auf der Höhe der wahren Berufung von Mann und Frau zu halten, sind von Paul VI. beschrieben worden. […] Eine nicht nur wirtschaftliche Entwicklung misst und orientiert sich an dieser Wirklichkeit und an dieser Berufung des Menschen in seiner gesamten Existenz, das heißt, an einer Art von Maßstab, der ihm selbst innewohnt.« (Johannes Paul II., Sollicitudo rei socialis , Abschnitt 28–29).
1Einer neuen Idee der Wirklichkeit Ausdruck zu verleihen, ist das Ziel des Nachsynodalen Apostolischen Schreibens Querida Amazonia , das auf den 20. Februar 2020, also auf einen Zeitpunkt datiert ist, als das Virus bereits Italien heimzusuchen begonnen hatte. Beobachtern war die Entscheidung der Pan-Amazonien-Synode (Rom, 6. bis 27. Oktober 2019) und des anschließenden Apostolischen Schreibens, sich auf den Lebensraum Amazonien zu konzentrieren, ohne jegliche globale Relevanz erschienen. In Wahrheit handelt es sich dabei um den alles entscheidenden Faktor. Wir befinden uns nach wie vor mitten in einer weltweiten Pandemie, die uns sehr deutlich zeigt, dass »alles miteinander verbunden« ist ( Laudato si’ , 16, 91, 117, 138, 240) und der Mensch nicht als isoliertes Individuum, sondern als Person mit Beziehungen betrachtet werden muss. Eine gesellschaftliche und kulturelle Wende, die den Auftakt zu einem »ökologischen Wandel« (Gaël Giraud) bildete, könnte auch zu einer Neuorientierung des kirchlichen Dienstes führen, ihn in Richtung jeglichen menschlichen Seins und aller Menschen lenken.
Erster Teil
Carlo Petrini
Am 13. September 2013 hielt ich mich wegen meiner Arbeit in Paris auf, als das Telefon klingelte. Unbekannte Nummer, zeigte das Smartphone an. »Papst Franziskus hier«, hörte ich mein Gegenüber, und in einer Mischung aus Ungläubigkeit und Erregung begannen wir eine Unterhaltung, die mit einer virtuellen Umarmung endete. Eine Woche zuvor hatte ich ihm einen Brief geschrieben, nachdem er zum Zeichen der Solidarität mit den über das Mittelmeer geflüchteten Migranten seine erste offizielle Reise nach Lampedusa angetreten hatte; doch ich hätte mir niemals träumen lassen, seine Stimme am anderen Ende der Leitung zu hören. Wir unterhielten uns über die Erde, über Ökologie, über Ernährung und Religion. Wir sprachen über unsere Großmütter und über die Weisheit der piemontesischen Bauern. Wir lachten und nahmen uns fest vor, uns bald persönlich zu treffen.
Diesem ersten Telefonat folgten etliche Briefe, und so entstand gemeinsam mit meinem Freund, dem Bischof von Rieti, Domenico Pompili, allmählich die Idee zu den Laudato-si’-Gemeinschaften. Es sollte sich dabei um spontane, heterogene Gruppen von Menschen unterschiedlichster Herkunft handeln, die der Wunsch vereint, das zentrale Thema der Enzyklika Laudato si’ von Papst Franziskus, nämlich das Konzept der »ganzheitlichen Ökologie«, voranzubringen. Die Gelegenheit war günstig und die Zeit reif; gemeinsam suchten wir den Heiligen Vater auf, um ihm das Projekt vorzustellen. Sofort bestand Einigkeit. Franziskus und ich sind zwei Menschen mit extrem unterschiedlichen Biografien und Erfahrungen, aber wir haben sehr schnell zueinandergefunden. Ein Agnostiker und ein Papst, ein Exkommunist und ein Katholik, ein Italiener und ein Argentinier, ein Gastronom und ein Theologe. Aus dieser ersten Begegnung erwuchs die Idee zu einem Dialog, der in Buchform gebracht werden könnte. Die folgenden Seiten sind das Ergebnis dieses Austauschs, der sich während dreier Treffen innerhalb von drei Jahren entwickelt hat. Wir haben uns entschlossen, das Gesagte nicht zu aktualisieren und es zu belassen, wie es ist, um es in seinem historischen Moment und als Frucht des Augenblicks, in dem es entstanden ist, zu bewahren. Drei Gespräche, die versuchen, einige der großen Fragen unserer Zeit ungezwungen, aber nicht verkürzend, ernsthaft, aber heiter zu ergründen. Im Anschluss daran finden Sie vertiefende Beiträge zu den einzelnen Themen, die das Ergebnis individueller, aber miteinander einhergehender und in dieselbe Richtung weisender Reflexionen sind. Viel Spaß beim Lesen!
Carlo PetriniIch habe Ihnen etwas mitgebracht, ein Buch, das ich gemeinsam mit José »Pepe« Mujica und Luis Sepúlveda verfasst habe. Es heißt Vivere per qualcosa (»Für etwas leben«).
Papst FranziskusIch werde es gerne lesen.
CWir sind drei etwas eigensinnige Persönlichkeiten, jeder mit seinen Besonderheiten, aber wir waren uns sofort einig. Wir schätzen uns gegenseitig sehr. Außerdem hege ich große Bewunderung für Pepe und Luis, weil sie außergewöhnliche Menschen sind, die ihr Leben dem aktiven Kampf für eine bessere Welt gewidmet haben. Sie haben gekämpft, ohne sich jemals von den Ereignissen unterkriegen zu lassen, und haben stets Rückgrat bewiesen.
FPepe ist tüchtig, wirklich tüchtig, er hat öffentliche Ämter bekleidet, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Er ist immer Bauer geblieben!
CEr ist ein Phänomen. Und auch Luis Sepúlveda ist eine großartige Persönlichkeit. Man hat uns gefragt, wofür es sich lohnt zu leben, und wir haben versucht, die Frage zu beantworten. Und wir waren uns einig, dass es sich tatsächlich für den Einsatz für eine gerechte Sache zu leben lohnt. So mühsam es auch sein mag, ist das doch die wahre Quelle des Glücks.
FGut, ich danke Ihnen. Lassen Sie uns nun schauen, welche Geschenke ich für Sie mitgebracht habe: Dieses Buch ist ein Interview, das Dominique Wolton mit mir auf Französisch geführt hat; das hier ist die italienische Übersetzung. 1
Читать дальше