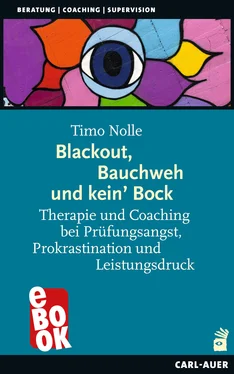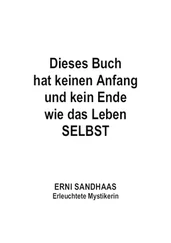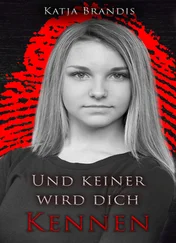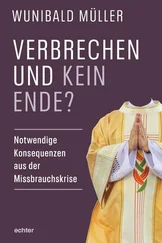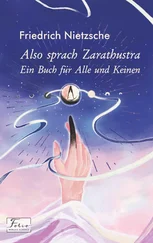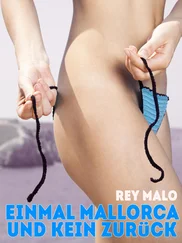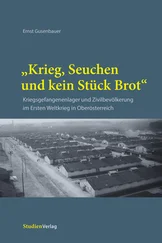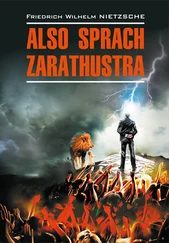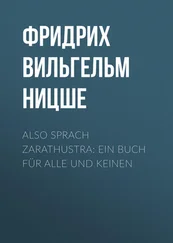2.2.2Reden über Lernen und Prüfungssituationen
2.2.3Mentale Landkarte
2.2.4Intervall-Lernen
2.2.5Tägliches Lernen
2.2.6Lernzeit greifbar machen
2.2.7I’ll be back – die Terminator-Planungstechnik
2.2.8Psychologisch orientiertes Prüfungstraining
2.2.9Nützliche Rituale für die passende Einstellung beim Lernen
2.2.10Lieblingsprüfungsaufgabe: Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung
2.2.11Strategien für schriftliche Klausuren
2.2.12Miteinander reden: die wichtigste Art zu lernen
3Selbstregulation
3.1Theorien und Modelle von Aufregung und Prüfungsangst
3.1.1Interferenz-Modell und »Choking under pressure«
3.1.2Selbstregulations-Modell
3.1.3Selbstwert-Modell
3.1.4Die Polyvagal-Theorie: ein neuer Blick auf Prüfungsangst
3.1.5Die Bedeutung der Selbstregulation in Prüfungssituationen
3.1.6Prüfungstrauma
3.1.7Selbstwirksamkeitserwartung
3.1.8Inneres Schrumpfen
3.1.9Selbstregulation durch Atmung
3.1.10Embodiment: Wie die Haltung die Emotion verändern kann
3.1.11Die Macht der Erklärung
3.1.12Wechselwirkungen mit anderen Bereichen
3.1.13Haltung im Bereich Selbstregulation
3.2Methoden im Bereich Selbstregulation
3.2.1Anliegenklärung
3.2.2Reden über Angst
3.2.3Stärkende Kommunikation: Selbstwirksamkeit durch Umfokussierung
3.2.4Power-Talk
3.2.5Anti-Blackout-Training (ABT)
3.2.6Mentale-Stärke-Training (MST)
3.2.7Kopf hoch – positives Embodiment
3.2.8Die fliegende Kiste: Intervention bei Prüfungstrauma
3.2.9Beruhigendes Atmen
3.2.10Atemanhalte-Training
3.2.11Klopfen
4Ziele
4.1Theorie
4.1.1Die Suche nach der Wirksamkeit von Zielen
4.1.2Drei Zielebenen
4.1.3Unterschied zwischen Motivation in der Schule, im Studium und in der Ausbildung
4.1.4Intrinsische und extrinsische Motivation und die Bedeutung der Selbstbestimmung
4.1.5Belohnung und der Korrumpierungseffekt
4.1.6Wechselwirkungen mit anderen Bereichen
4.1.7Haltung bei der Arbeit mit Zielen
4.2Methoden für die Arbeit mit Zielen
4.2.1Anliegenklärung
4.2.2Reden über Ziele
4.2.3Zwischenziele beschreiben
4.2.4Sprung in die Zukunft
4.2.5Das anziehende Ziel finden
5Entscheidungen, Prokrastination und Stagnation
5.1Theorie
5.1.1Entscheidungen sind wichtig für Entschlossenheit
5.1.2Prokrastination als Selbstschutz
5.1.3Stagnation: Das Zielgeradensyndrom
5.1.4Haltung bei Entscheidungskonflikten, Prokrastination und Stagnation
5.2Entscheidungsmethoden
5.2.1Anliegenklärung
5.2.2Aktive Nichtentscheidung
5.2.3Nachträgliche Dafür-oder-dagegen-Entscheidung
5.2.4Katastrophenfrage
5.2.5Verdeckte Aufstellung mit verzögerter Rückmeldung
5.3Methoden bei Stagnation und Prokrastination
5.3.1Anliegenklärung
5.3.2Problem-Lösungs-Balance
5.3.3Verfallsdatum von Möglichkeiten
6Loyalitätskonflikte und komplexe Blockaden
6.1Theorie
6.1.1Loyalität
6.1.2Den hemmenden Loyalitäten auf der Spur
6.2Methode: Ambivalenz- und Blockaden-Check (ABC)
6.2.1Wofür kann der ABC eingesetzt werden?
6.2.2Ablauf des Ambivalenz- und Blockaden-Checks
7Leistungsdruck und Gelassenheit
7.1Theorie
7.1.1Kommt Druck von außen oder von innen?
7.1.2Leistungsdruck und Überarbeitung systemisch betrachtet
7.1.3Subjektive Imperative: Wie aus Leistungserwartung Leistungsdruck wird
7.1.4Wo lauert die Gefahr?
7.1.5Versteckte Imperativkonflikte
7.1.6Schuldgefühle als Blockade
7.1.7Die Macht der Haltung
7.1.8Entstehung von Haltungen in Lern- und Leistungskontexten
7.1.9Bewertung im Kontext
7.1.10Der Einfluss von Eltern und Lehrpersonen auf die Entstehung von Misserfolgsängstlichkeit
7.1.11Perfektionismus oder Lust an Höchstleistung?
7.1.12Leistungssituationen als Differenzierungstraining
7.1.13Gelassenheit in Leistungssituationen
7.1.14Grundbedürfnis nach Autonomie und die fünf Freiheiten von Virginia Satir
7.1.15Wechselwirkungen mit anderen Bereichen
7.2Methode: Imperativ-Transformations-Technik (ITT)
7.2.1Ziel und Haltung mit der ITT
7.2.2Vorbehalte gegen die Auflösung von Imperativen
7.2.3Anschlussmöglichkeiten mit anderen Verfahren
7.2.4Trennung verschiedener Ebenen durch Gesten und Bewegungen
7.2.5Ablauf der Imperativ-Transformations-Technik
8Coaching bei Auftritts- und Redeangst
8.1Auftrittscoaching – nicht nur für Profis
8.2Merkmale von Auftrittssituationen
8.3Unterschied zwischen schriftlicher Klausur und mündlicher Prüfung
8.4Beziehungsdynamik auf der Bühne
8.5Vier Seiten der Auftrittsangst
8.5.1Kompetenzbewusstsein
8.5.2Fehlertoleranz
8.5.3Selbstbewusstsein
8.5.4Verletzlichkeit
8.6Dreischritt für eine gute Struktur bei Auftritten
8.7Dreischritt für Präsenz auf der Bühne
Ausblick
Übersicht der Techniken
Danksagung
Literatur
Über den Autor
Geleitwort
Wege zu Lernfreude, Wohlbefinden und Spitzenleistung
In einer sich schnell wandelnden Welt, die zunehmend durch Globalisierung, Digitalisierung, den wachsenden Gegensatz zwischen Arm und Reich sowie die Folgen des Klimawandels bestimmt wird, stehen wir vor der Herausforderung, die nachwachsende Generation so umfassend zu bilden, dass sie in der Lage ist, zukunftsorientiert mit der immer größer werdenden Komplexität umzugehen. Dies kann nur gelingen, wenn sie über die »21st Century Skills« verfügt, die Trilling und Fadel (2012) in ihrer wegweisenden Studie als »Learning for life in our times« beschreiben. Das Lernen für ein Überleben im 21. Jahrhundert basiert demnach auf der Befähigung zu kritischem Denken und Problemlösen, zu Kommunikation und Kollaboration sowie zu Kreativität und Innovation. Hier stellen sich zwei Fragen: Wie werden Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen diesem umfassenden Anspruch gerecht? Und was können wir tun, damit – wie ich es in Positive Pädagogik (Burow 2011) beschrieben habe – Lernfreude mit Wohlbefinden und Spitzenleistungen verbunden wird?
Was die erste Frage betrifft, kommen wir zu einer desillusionierenden Erkenntnis bezüglich der Zukunftsfähigkeit von Bildungseinrichtungen. Zu viele sind traditionellen Belehrungsformaten verhaftet, setzen nach wie vor auf frontale Vermittlung von Wissen, das nach Fachgebieten aufgeteilt ist und zudem häufig in unpersönlichen Multiple-Choice-Klausuren abgefragt wird. Zeitgemäße, persönlichkeitsbildende, Kreativität und Engagement fördernde Lehre sieht anders aus. Durch die einseitige Fixierung auf unpersönliche, überwiegend kognitive Wissensvermittlung werden Lehrende wie Lernende gleichermaßen überfordert: Während Erstere häufig Schwierigkeiten haben, ihre Adressaten zu erreichen, sehen sich Letztere zu selten in ihren Talenten erkannt, weswegen eine beträchtliche Anzahl Motivations- und Überforderungsprobleme entwickelt. Diese Diagnose gilt gleichermaßen für zu viele Unterrichtsangebote von Schulen wie auch zu viele Studiengänge der Universitäten im normierten Bachelor-Master-Format. Schulen, aber auch Hochschulen folgen – wie es der Theaterpädagoge Ken Robinson in seinem TED-Talk »Changing education paradigms« eindrücklich darstellt hat – nach wie vor Vermittlungsmustern, die sich am Industriezeitalter und an der Massenproduktion orientieren. Personenzentrierte, auf individuelle Neigungen und Talente zugeschnittene Angebote, wie sie die Humanistische Psychologie und die Positive Pädagogik entwickelt haben, bleiben die seltene Ausnahme.
Читать дальше