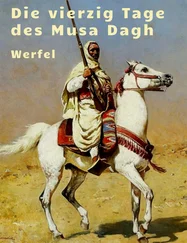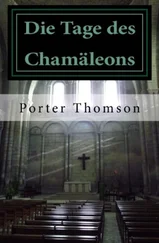Sehen kann, sehen konnte Sehen kann, sehen konnte Ich kam in den Copyshop und hörte jemanden brummeln: »Scheiß Terroristen«. »Das ging schnell«, dachte ich. »Woher will er wissen, dass es kein Unfall war?« Ich wollte mit Kreditkarte bezahlen, aber die Frau sagte: »Alle unsere Verbindungen sind tot wegen dem, was gerade passiert ist.« Sie holte ein Formular hervor, von dem ich gar nicht gewusst hatte, dass es das gibt; ich füllte es aus, und sie sagte, sie würde die Zahlung später durchführen. »Hier war eben ein Mann«, sagte sie. »Der war zu spät dran gewesen für ein Meeting im World Trade Center und zitterte richtig.« Sie sah nach draußen. »Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie’s aussieht.« Das Ungeheuerliche dieses Morgens schlug sich bei mir zuallererst in einer logistischen Frage nieder: Von wo aus könnte ich am besten etwas sehen? Von wie weit weg? Von wie hoch? »Ich wohne im East Village; meine Fenster gehen nach Süden. Ich habe ja die zarten Baumschatten an den Gebäuden auf der anderen Straßenseite gesehen.« Ich hatte vergessen, und es fiel mir dann wieder ein, dass ich das World Trade Center von meinem Fenster aus jeden Tag sehen kann, sehen konnte. Ich stieg vier Treppen hoch, setzte mein Zeug ab und ging in den vorderen Raum.
Was ich vom Fenster aus sah Was ich vom Fenster aus sah Beide Türme brannten. Konnte das Flugzeug quer durch beide geschlagen sein? Ich hatte nie darauf geachtet, wie schuppenartig ihre Fenster aussahen. Beide Gebäude sahen aus wie abbrennende Fische. Wie Jennifers geräucherter Fisch auf seinem Wachspapier, nur in Brand geraten. Wie zwei Lungenflügel, nur in Brand geraten. Wie zwei Bienenkörbe: intakte Zellen unten, zerstörte Zellen oben, eine orange Flammenschicht als Trennmarke zwischen vollständig und verwüstet. Dann hüllte Rauch den Südturm ein, und weg war er.
Sommer 1996 Sommer 1996
Es war einmal Es war einmal Vor fünf Jahren bin ich mit zwei Freundinnen hierhergezogen, Jan und Janna. Verliebt in unser neues Leben nahmen wir die U-Bahn rauf zu den Cloisters im Norden und runter zum Battery Park im Süden. Wir nahmen die schaukelnde Seilbahn über den Fluss nach Roosevelt Island, wir fuhren Kajak auf dem Hudson, wir spazierten über die Brooklyn Bridge. Einmal nahmen wir spätabends den Aufzug zur obersten Etage des World Trade Centers. Es gab da eine Stelle, wo man kostenlos aus dem Fenster schauen konnte. Die Welt, die wir sahen, war schwarz und blau und golden, Keile und Säulen aus hellen Fenstern und dunklem Stahl. Kleine, aber gut sichtbare Männer und Frauen machten Nachtschicht an ihren Schreibtischen, eingerahmt und erleuchtet wie byzantinische Heilige. Die Bauten strahlten aufwärts, erhellten den Himmel und sich gegenseitig in der Höhe. Weit unten sahen wir winzige Straßen, deren bloße Namen schon – innerhalb einer Reißbrettstadt aus nummerierten Gebäudeblöcken und Fahrdämmen – schummrig, schmal und nach Dickens klangen: Old Slip, Coenties Slip, Thames, Vesey, Gouverneur und Maiden Lane. Von oben bildeten sie in der Nacht ein dunkles Filigran, eine Patina, aus der die leuchtenden Türme umso heller aufflammten. All das machte uns ganz schwach vor Wonne. Als wir uns sattgesehen hatten, nahmen wir den Aufzug wieder hinunter, schauten hoch in dessen verspiegelte Decke und drehten uns mit ausgebreiteten Armen im Kreis. Und jede von uns sagte auf ihre Weise dieses Gebet an die Stadt, die wir eben gesehen hatten: »Ergreife mein Herz. Nimm mich mit.«
11. September 11. September
Es ist kein Unfall Es ist kein Unfall Nachdem ich den Südturm verschwinden gesehen hatte, schaltete ich das Radio ein, und Sharon rief an. »Ich hab schon mal angerufen. Hast du meine Nachricht bekommen?« »Ich hab keine Nachrichten abgehört; das World Trade Center stand in Flammen.« »Das Pentagon haben sie auch getroffen.« »Was für ein Pentagon? Gibt es in Manhattan einen fünfeckigen Park?« »Nein, das Pentagon-Pentagon.« »O Gott. Es sind also zwei Flugzeuge gewesen?« »Nein, es sind drei Flugzeuge gewesen. In jeden Turm ist ein Flugzeug geflogen, und eins ins Pentagon.« Mein Herz schlug heftig, und meine Hände wurden kalt und kribbelten. »Auch wenn die Stadt nicht brennt«, sagte ich, »könnte es sein, dass sie Strom und Wasser abstellen. Ich sollte Essen besorgen. Rufst du mich in einer Dreiviertelstunde noch mal an?« »Ich werd’s versuchen, aber ich krieg immer öfter Besetztzeichen.« Ich griff gleich noch mal zum Telefon, um meine Mutter anzurufen, aber ich kam nicht durch.
Nur wir selbst, noch mehr als sonst Nur wir selbst, noch mehr als sonst »Sharon?«, sagte ich, als das Telefon noch mal geklingelt hatte. »Ich bin’s, Akiko. Bist du okay? Sharon auch? Und deine Freundinnen?« »Ja, ja, bis jetzt ja. Und du? Und dein Mann?« »Ja, ja. Bei uns sagt man, das ist kowai«, sagte sie. »Das ist gruselig.« »Aha, kawaii bedeutet niedlich, aber kowai gruselig.« »Ja, total andere Bedeutung. Ich würde immer noch gern morgen zu dir nach Hause kommen, allerdings nur vielleicht.« »Vielleicht wird das ein bisschen schwierig. Vielleicht ein anderes Mal.« »Ja, das würde mich freuen.« Sie machte eine Pause. »Meinst du, ich sollte heute den Kurs besuchen?« »Vielleicht ist zu Hause bleiben besser«, sagte ich. »Okay. Kiotsukete«, sagte sie, »mach’s gut.« »Pass auf dich auf, Akiko-san«, sagte ich. Akiko und ich erlernten zusammen die japanische Teezeremonie und halfen uns gegenseitig beim Japanisch- und Englischüben. Ich fühlte mich davon geschmeichelt, dass sie glaubte, ich würde wissen, was jetzt zu tun sei. Ich dachte über sie da ganz allein in ihrer Hochhauswohnung in der 9. Etage nach. Wenn ihr Gebäude in Brand geraten würde, könnte sie in der Falle sitzen. Wenn der Strom ausfallen würde, müsste sie die ganzen Treppen runter. Und wenn sie aus ihrer Wohnung geflüchtet wäre, wäre es entsetzlich für sie, völlig allein und mit ganz gutem, aber nicht herausragendem Englisch ihren Mann suchen zu müssen. Ich dachte an den Teekurs, das flache Gebäude, den tief gelegenen Keller mit seinen Steinmauern, die vollkommene Ruhe der Lehrenden, die Anwesenheit anderer Japanisch Sprechender. Beim dritten Versuch kam ich mit dem Anruf durch. »Vielleicht solltest du doch zum Kurs gehen«, sagte ich. »Vielleicht ist das sicherer. Kannst du deinen Mann anrufen und ihm die Nummer von dort geben?« »Okay«, sagte sie. »Danke fürs Anrufen.« »Kiotsukete«, sagte ich. »Pass auf dich auf«, sagte sie.
Zwei Sekunden Zwei Sekunden Nach Akikos Anruf machte ich mich auf zum Einkaufen. Als ich losging, stand der Nordturm da wie ein Körper mit aufgesägter Brust und flammendem Herzen darin. Ich hörte die Sirenen durch die Second Avenue heulen und war mir immer noch sicher, dass die Feuerwehr ihn retten könnte. Ich kaufte vier Liter Wasser, einen Liter Sprudel, tiefgefrorene Teigtaschen mit Shrimps (falls Herd und Kühlschrank weiter funktionieren sollten), einen Beutel Babymöhren, drei Joghurts, zwei Gemüsesäfte, einen Orangensaft und eine Packung Cracker. Und weil sie ja vielleicht meine letzten sein konnten, kaufte ich mir Leckereien: einen Becher Cashewmus, Toblerone, frische Feigen. Ich entdeckte noch eine Packung Kerzen und kaufte auch die. Als ich so meine Einkaufskörbe füllte, sah ich ein ganz kleines Kind systematisch jeden einzelnen Schokoriegel anfassen, während die drängelnde Stimme einer Frau nach »Lucy! Lucy!« rief. Schließlich schnappte sich die Frau ihr Kind und rüttelte es kurz. »Ich dreh mich für zwei Sekunden um, und was passiert?« Glotzend wie ein Survival-Yuppie stand ich mit meinen schweren Einkaufskörben an der Kasse hinter einem Mann, der völlig gelassen eine einzelne Chipstüte kaufte, und hinter Lucy und ihrer Mutter, die ein Trinkpäckchen und Blattsalat kaufte. Ich fühlte mich wie diese einsam rennende Frau vom Astor Place. Als ich nach draußen kam, scharten sich auf dem Gehweg zwanzig Leute um einen Fernseher, und jemand filmte sie dabei. Und auf dem Weg nach Hause sah mir ein Mann in die Augen ohne Flirtversuch. »Ist das nicht furchtbar?«, sagte sein Gesichtsausdruck. Sein Mitgefühl brannte sich mir irgendwie ein. Und als ich oben auf der Treppe ankam und aus dem Fenster sah, war der Nordturm verschwunden.
Читать дальше