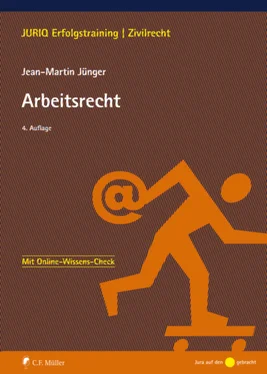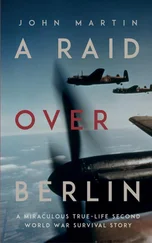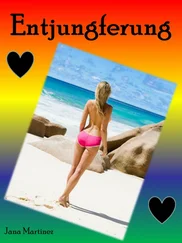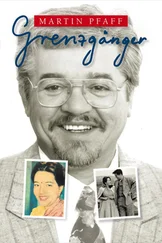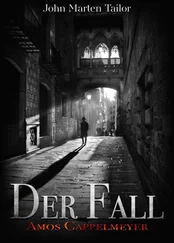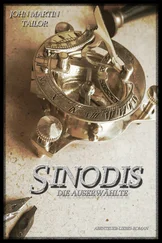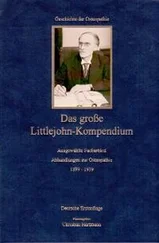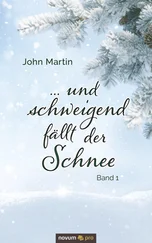B. Struktur des Arbeitsrechts
C. Rechtsquellen des Arbeitsrechts und ihre Rangfolge
I. Normenhierarchie
II. Quellen
1. Europarecht
2. Verfassungsrecht
3. Einfaches Recht
4. Sonstige Rechtsquellen
2. Teil Individualarbeitsrecht
A. Grundbegriffe
I. Arbeitsvertrag
II. Arbeitnehmer
1. Privatrechtlicher Vertrag
2. Vertrag nach §§ 611a Abs. 1 S. 1 BGB
3. Unselbstständigkeit der Dienstleistung
III. Arbeitnehmerähnliche Personen
IV. Scheinselbstständigkeit
V. Übungsfall Nr. 1
VI. Arbeitgeber
VII. Betrieb
1. Organisatorische Einheit
2. Verfolgung eines arbeitstechnischen Zwecks
VIII. Betriebsrat
1. Betriebsratsfähigkeit des Betriebs
2. Aufgaben des Betriebsrates
B. Die Anbahnung und Begründung eines Arbeitsverhältnisses
I. AGG-Schutz des Arbeitnehmers
1. Die Benachteiligung
2. Ausnahmsweise gerechtfertigte Benachteiligung
3.Rechtsfolgen
a) § 15 AGG
b) Beweislastverteilung im Rahmen des § 15 AGG
c) Höhe des Schadensersatz- und Entschädigungsanspruchs
d) Entgelttransparenzgesetz
II. Der Arbeitsvertrag
1. Wirksamkeit des Arbeitsvertrags
a) Beschränkte Geschäftsfähigkeit
b) §§ 134, 138 Abs. 1 BGB
2. Die Anfechtung des Arbeitsvertrages
a) Anfechtung wegen arglistiger Täuschung
b) Eigenschaftsirrtum
c) Fragenkatalog
3. Das fehlerhafte Arbeitsverhältnis
4. Übungsfall Nr. 2
5. Abwandlung zu Übungsfall Nr. 2
6. Die AGB-Kontrolle
a) Anwendung der AGB-Kontrolle auf Arbeitsverträge
b) Allgemeine Geschäftsbedingung
c) Wirksamer Einbezug der AGB in den Vertrag
d) Verdrängung durch vorrangige Individualabrede?
e) Keine überraschende Klausel im Sinne von § 305c Abs. 1 BGB
f) Auslegung
g) Die Inhaltskontrolle am Maßstab der §§ 307 Abs. 1 und 2, 308 und 309 BGB
h) Rechtsfolgen
7. Betriebliche Übung
8. Gesamtzusage
C. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
I.Hauptleistungspflichten
1. Arbeitnehmer
2. Arbeitgeber
II. Nebenpflichten
1. Arbeitnehmer
2. Arbeitgeber
III. Leistungsstörungen im Arbeitsverhältnis
1.„Ohne Arbeit kein Lohn“
a) Verzug des Arbeitnehmers
b) Unbezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht
2. „Lohn ohne Arbeit“
a) Mutterschaftsentgelt
b) Erholungsurlaub und gesetzliche Feiertage
c) Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit im Krankheitsfall
d) Unmöglichkeitsentgelt
e) Vorübergehende Verhinderung nach § 616 BGB
f) Annahmeverzug des Arbeitgebers
g) Freistellung bis zum Ende der Kündigungsfrist
h) Betriebsrisiko, § 615 S. 3 BGB
i) Übungsfall Nr. 3
j) Besonderheiten in der Haftung
k) Übungsfall Nr. 4
IV.Beendigung des Arbeitsverhältnisses
1. Allgemeines
2. Befristung
a) Sachgrundbefristung
b) Sachgrundlose Befristung
c) Formvorschrift
d) Ende des Arbeitsverhältnisses
3. Auflösende Bedingung
4. Aufhebungsvertrag
a) Zustandekommen des Aufhebungsvertrages
b) Form
c) Widerruf
V. Die Kündigung
1. Die Zulässigkeit einer Kündigungsschutzklage
2. Die Begründetheit einer Kündigungsschutzklage
a) Ordnungsgemäße Kündigungserklärung
b) Kein Ausschluss der ordentlichen Kündigung
c) Zustimmungsbedürftigkeit
d) Die Anhörung des Betriebsrates
e) Anzeigebedürftigkeit
f) Einhaltung der Klagefrist, §§ 4, 7 KSchG
g) Voraussetzungen nach dem Kündigungsschutzgesetz
h) Die außerordentliche Kündigung, § 626 BGB
i) Änderungskündigung
j) Verdachtskündigung
k) Druckkündigung
l) Kündigungsschutz im Kleinbetrieb
m) Der besondere Kündigungsschutz
3. Übungsfall Nr. 5
D. Der Betriebsübergang, § 613a BGB
I. Überblick
II. Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des § 613a BGB
1.Übergang eines Betriebs(-teils)
a) Betriebs(-teil)
b) Übergang
c) Auf einen anderen Inhaber
2. Vorliegen eines Rechtsgeschäfts
3. Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers
III. Unterrichtung über den Betriebsübergang
IV.Rechtsfolgen des Betriebsübergangs
1. Übergehen des Arbeitsverhältnisses
2. Haftung
3. Kündigungsverbot „wegen“ des Betriebsübergangs
3. Teil Kollektivarbeitsrecht
A. Das Koalitionsrecht
I. Begriff der Koalition
II. Merkmale der Koalition
1. Zweckbestimmung
2. Freiwilligkeit und Dauerhaftigkeit
3. Gegnerunabhängigkeit
4. Sonstige Voraussetzungen
B. Tarifvertragsrecht
I. Tarifvertrag
II. Wirksames Zustandekommen eines Tarifvertrages
1. Einigung
2. Parteien des Tarifvertrags
a) Tariffähigkeit
b) Tarifzuständigkeit
3. Form
III. Aufgaben eines Tarifvertrags
IV. Bindung an den Tarifvertrag
1. Voraussetzungen der Tarifgebundenheit
2. Geltungsbereich
3. Allgemeinverbindlichkeit
4. Rechtsfolge der Bindung
C. Das Arbeitskampfrecht
I. Begriff
II. Streik
1. Rechtmäßigkeit des Streiks
2. Legitimes Ziel
3. Kein Verstoß gegen die Friedenspflicht
4. Organisation durch eine Gewerkschaft
5. Verhältnismäßigkeit
6.Rechtsfolgen
a) Rechtmäßiger Streik
b) Rechtswidriger Streik
c) Folgen für unbeteiligte Arbeitnehmer
III. Die Aussperrung
1. Rechtmäßigkeit
2. Rechtsfolgen
D. Das Betriebsverfassungsrecht
I. Grundsätzliche Prinzipien
II. Räumlicher Geltungsbereich
III. Sachlicher Geltungsbereich
IV. Persönlicher Geltungsbereich
V. Organe der Betriebsverfassung
VI.Der Betriebsrat
1. Rechtsstellung
2. Schutz des Betriebsrates
3. Rechte des Betriebsrats
a) Informationsrechte
b) Widerspruchsrechte
c) Anhörungsrechte
d) Beratungsrechte
e) Zustimmungsverweigerungsrechte
f) Zustimmungsrechte
4. Beteiligung in besonderen Angelegenheiten
a) Soziale Angelegenheiten, §§ 87 ff. BetrVG
b) Personelle Einzelmaßnahmen, §§ 99 ff. BetrVG
5. Betriebsvereinbarung/Regelungsabrede
a) Betriebsvereinbarung
b) Regelungsabrede
4. Teil Das Verfahren vor den Arbeitsgerichten
A. Aufbau
B. Zuständigkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit
C. Verfahrensarten
I. Urteilsverfahren
1. Zulässigkeit einer Klage vor dem Arbeitsgericht
a) Sachliche Zuständigkeit
b) Örtliche Zuständigkeit
c) Parteifähigkeit
d) Prozessvertretung
e) Prozessfähigkeit und Prozessführungsbefugnis
2. Begründetheit der Kündigungsschutzklage
a) Die besondere Kündigungsschutzklage
b) Die allgemeine Feststellungsklage wegen eines Kündigungssachverhalts
c) Der kombinierte Feststellungsantrag
3. Feststellungsklage
4. Leistungsklage
5. Gestaltungsklage
II. Beschlussverfahren
1. Sachliche Zuständigkeit
2. Örtliche Zuständigkeit
3. Beteiligte
4. Prozessvertretung
5. Sonstige Besonderheiten
Sachverzeichnis
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Читать дальше