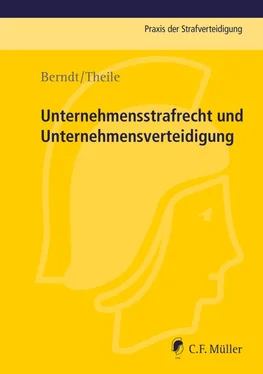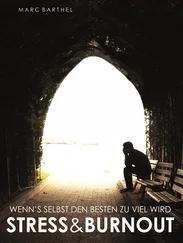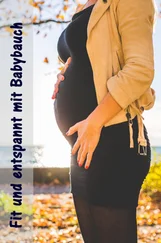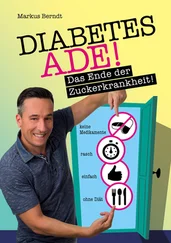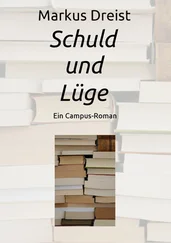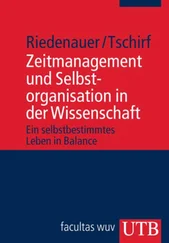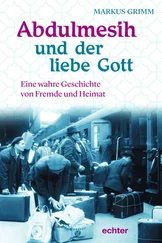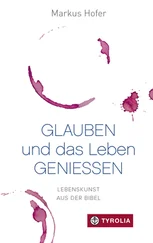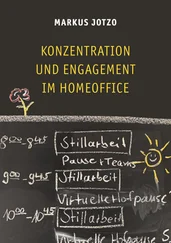14
Aber selbst wenn man diese der lex lata zugrunde liegende Komplexitätsreduktion als Ausgangspunkt nimmt, besteht die eigentliche Problematik des straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Umgangs mit Unternehmenskriminalität darin, dass anders als in Fällen der konventionellen Eigentums- und Vermögenskriminalität Information, Entscheidung und Handlung im Regelfall nicht in ein und derselben Person zusammenfallen, sondern in Unternehmen auf unterschiedliche Personen verteilt sind.[4] Die Schwierigkeiten potenzieren sich noch dadurch, als aus dem Unternehmenswirken entstehende Rechtsgutsverletzungen oftmals gar nicht auf eine einzelne Handlung bezogen werden können, sondern das Ergebnis langjähriger Fehlentwicklungen sind, die durch mangelndes Risikomanagement gekennzeichnet sind.[5] Unabhängig davon, ob dies im Sinne einer „organisierten Unverantwortlichkeit“ intendiert ist oder schlicht aufgrund der Eigenheiten des Unternehmenszusammenhanges geschieht, liegt es nahe, dass hieraus für das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht Probleme erwachsen.[6] Zwar wird teilweise eingewandt, Unternehmenskriminalität zeichne sich gar nicht durch erhöhte Beweisschwierigkeiten aus, da die formelle innerbetriebliche Organisation fortlaufend zur Dokumentation von Entscheidungsabläufen zwinge.[7] Die oftmals beklagten Probleme bezögen sich demnach weniger auf die Unmöglichkeit, sondern auf die faktische Unzumutbarkeit der Beweisführung.[8] Unabhängig davon, ob im Hinblick auf die Beweisführung von Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit auszugehen ist, besteht jedoch kein Zweifel, dass insoweit erhebliche praktische Schwierigkeiten auftreten.[9]
15
Die Problematiken bestehen gleichermaßen im Horizontalverhältnis von Individuen auf gleicher Hierarchieebene wie im Vertikalverhältnis von Individuen auf hierarchisch unterschiedlichen Stufen, weshalb in diesem Bereich jeweils spezifische Schwierigkeiten in der Zurechnung und der Implementation des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts entstehen: „An den Klippen der Arbeitsteilung zerschellen die klassischen Prinzipien der Verantwortlichkeit“.[10] Hinzu kommt der bereits angesprochene Aspekt, dass moderne Unternehmen oftmals gar nicht mehr durch ausschließlich hierarchische, sondern auch durch heterarchische Organisationsformen geprägt sind. Vor diesem Hintergrund sind das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht, welches selbst im Zusammenhang mit der Verhängung einer Geldbuße gegenüber juristischen Personen und Personenvereinigungen die Feststellung einer individuellen Anknüpfungstat verlangt (vgl. § 30 Abs. 1 OWiG), vor die Herausforderung gestellt, Verantwortungsattributionen im Unternehmenskontext vorzunehmen.
16
Die folgende Darstellung unternimmt den Versuch, diesen Problemen auf sämtlichen Ebenen des Unternehmens sowohl in horizontaler als auch vertikaler Perspektive nachzugehen (siehe Rn. 17 ff.), bevor anschließend besonders praxisrelevante Instrumente dargestellt werden, wie auch nach geltendem Recht eine Sanktionierung von Unternehmen erfolgen kann (siehe Rn. 256 ff.). Schließlich sollen in einem Ausblick Perspektiven angedeutet werden, wie mit der Problematik einer Sanktionierung von Unternehmen de lege ferenda umgegangen werden könnte (siehe Rn. 398 ff.).
[1]
V. Giercke (1881), S. 603 f.; ders . (1902), S. 22.
[2]
V. Savigny (1840), § 85 S. 236 f.
[3]
Kempf/Lüderssen/Volk- Schmitt-Leonardy (2012), S. 111, 118. Siehe hierzu auch Röhl/Röhl S. 469 § 58.
[4]
Alwart ZStW 105 (1993), 752, 754; ders . in: Alwart (1998), S. 75, 79; Dannecker GA 2001, 101, 102 ff.; Ehrhardt (1994), S. 159 ff.; Heine (1995), S. 31 ff.; ders . in: Alwart (1998), S. 90, 91 f.; ders . ZStrR 2001, 22, 24 ff.; Mittelsdorf (2007), S. 10 ff.; Otto Jura 1998, 409, 410; Ransiek (1996), S. 191 ff.; Schünemann wistra 1982, 41, 42; ders. in: Madrid-Symposium Tiedemann (1994), S. 265, 271 f.; Kempf/Lüderssen/Volk- Theile (2012), S. 175, 177. Grundlegend auch Stratenwerth ZStW 105 (1993), 679, 681 f.
[5]
Heine (1995), S. 141; Otto (1993), S. 25; ders . Jura 1998, 409, 416.
[6]
Zum Begriff siehe insbesondere Schünemann (1979), S. 18, 34, 149 ff.; ders . wistra 1982, 41, 42. Siehe in diesem Zusammenhang auch Heine in: Alwart (1998), S. 90, 91; Otto Jura 1998, 409 f.
[7]
So etwa Schünemann (1979), S. 41 ff.; ders . wistra 1982, 41, 49.
[8]
Volk JZ 1993, 429, 433. Vgl. insoweit auch Krekeler in: FS Hanack (1999), S. 639, 660 ff.; Leipold NJW-Spezial 2008, 216 f.; ders . in: FS Gauweiler (2009), S. 375, 380; Schlüter (2000), S. 32; Seelmann in: FS Schmid (2001), S. 169, 171 f.
[9]
Vgl. hierzu Dannecker GA 2001, 101, 103 f.; Heine in: Alwart (1998), S. 90, 91 f.; ders . ZStrR 2001, 22, 24 ff.; Otto (1993), S. 7 ff.; ders . Jura 1998, 409, 410; Schünemann wistra 1982, 41, 42 f.; Stratenwerth in: FS Schmitt (1992), S. 295, 301. Siehe hierzu auch Kempf/Lüderssen/Volk- Theile (2012), S. 175, 177 f.
[10]
Luhmann (5. Aufl. 1999), S. 185.
Teil 2 Die rechtliche Bewältigung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Unternehmenskontext
Inhaltsverzeichnis
A. Straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Haftung von Personen auf Leitungsebene
B. Straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Haftung von Personen in Aufsichtsgremien
C. Weitere einschlägige dogmatische Problemfelder
17
Die bisherigen Ausführungen hatten deutlich gemacht, dass sich Unternehmenskriminalität erheblich von anderen Kriminalitätsphänomenen unterscheidet und spezifische Schwierigkeiten bestehen, im Unternehmenskontext begangene Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu sanktionieren (siehe Rn. 12 ff.). Gleichwohl sind Unternehmen keine „rechtsfreien Räume“ und Zugriffe des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts prinzipiell möglich, wenn sie nicht sogar aufgrund des im Strafrecht geltenden Legalitätsprinzips gefordert sind (vgl. §§ 152 Abs. 2, 160 Abs. 1 StPO). Der Versuch, in Unternehmenszusammenhängen begangene Rechtsverstöße mit den normativen Programmen des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts zu sanktionieren, hat jedoch zu einer verselbständigten Dogmatik geführt, die sich mitunter erheblich von der des Kernstrafrechts abhebt und konventionelle dogmatische Figuren an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringt. Dies alles wirft die Frage auf, ob und inwieweit angesichts der Eigenständigkeit überhaupt noch von einer Einheit innerhalb des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts die Rede sein kann. Verselbständigte Dogmatiken tragen sicher den Besonderheiten eines zu regulierenden gesellschaftlichen Lebens- und Handlungsbereichs Rechnung. Indes ist zu berücksichtigen, dass die wesentliche Funktion von Dogmatik darin besteht, grundlegende materiale Prinzipien des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts über Systematisierungsleistungen für die konkrete Rechtsanwendung operationalisierbar zu machen. In einem Pluriversum unterschiedlicher, jeweils nach gesellschaftlichen Lebens- und Handlungsbereichen ausdifferenzierten Dogmatiken, steht jedoch nicht nur die normative Orientierungssicherheit des Individuums, sondern möglicherweise der Bezug zu diesen materialen Prinzipien auf dem Spiel, wodurch die Identität des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts insgesamt gefährdet wird. Die Erstreckung des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts auf das Phänomen der Unternehmenskriminalität kann daher mit einer Überdehnung oder Deformation dieser Rechtsmaterien einhergehen.
Читать дальше