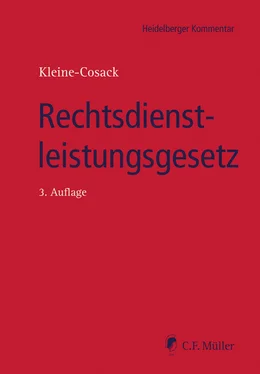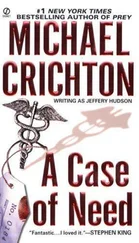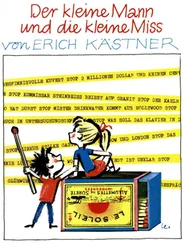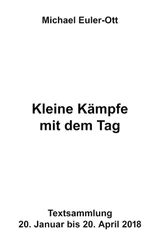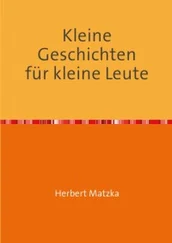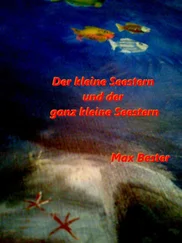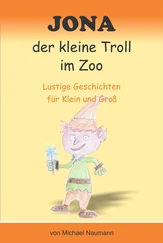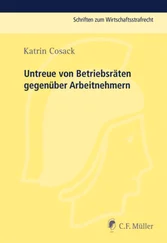bb) Ob spezialisierte Berufe minderer Qualifikation der freien Berufswahl offenstehen oder um wichtiger Gemeinschaftsbelange willen dem Vollberuf vorbehalten bleiben, richtet sich im übrigen nicht danach, ob für die Spezialisierung bereits ein hergebrachtes und vom Gesetzgeber geregeltes Berufsbild besteht. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in einigen Entscheidungen ausgeführt, dass in den ihnen zugrunde liegenden Fällen die Berufsfreiheit für solche herkömmlichen Spezialtätigkeiten beansprucht werden durfte, die nach Anforderungsprofil und Aufgabenbereich bekannt waren (BVerfGE 54, 301; 59, 302; 75, 284). Dieser Sachverhalt war insofern von Bedeutung, als hierdurch kenntlich gemacht werden konnte, dass es sich um Berufe im Sinne des Art. 12 Abs. 1 GG handelte. Die Entscheidungen schließen jedoch nicht aus, dass – wie im vorliegenden Fall – auch die Weiterentwicklung des Dienstleistungsmarktes neue Berufe hervorbringt, die den Schutz des Art. 12 Abs. 1 GG genießen. Dies ist vielmehr seit jeher unbestritten (vgl. BVerfGE 7, 377 <397>; 54, 301 <313>; 78, 179 <199>). Entgegen der Auffassung des Bundesgerichtshofs hängt die Anerkennung eines Berufes nicht davon ab, dass der Gesetzgeber bereits ein Berufsbild entwickelt hat. Dies könnte allenfalls von Bedeutung sein, wenn ohne Ausbildungsprofil und ohne spezielle Haftungsvorschriften eine Gefährdung der Kundeninteressen oder der Rechtspflege zu besorgen wäre. Beides ist hier nicht ersichtlich …“
b) Berufsausübungsfreiheit
107
In den meisten Fällen beinhaltet das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zumindest einen Eingriff in die durch Art. 12 I GG geschützte Berufsausübungsfreiheit derjenigen, welche rechtsdienstleistend tätig werden wollen bei der Ausübung eines Berufs.
108
Nur gering wirkt es sich aus z. B. bei der Vertretung von Behinderten durch Steuerberatern im sozialrechtlichen Verwaltungsverfahren;[156] hierbei handelt es sich eher um eine Hilfeleistung für den betroffenen Personenkreis. In den überwiegenden Fällen sind die Eingriffe in die Berufsausübungsfreiheit jedoch erheblich wie die umfangreiche Judikatur zum RBerG z. B. mit den Entscheidungen des BVerfG zum Erbenermittler, des BGH zu den Medien und zum Testamentsvollstrecker oder Fördermittelberater bzw. des BVerwG zur Insolvenzberatung gezeigt hat.
bb) Rechtmäßigkeitskriterien
109
Die Verfassungsmäßigkeit des mit dem Verbot der rechtsbesorgenden Tätigkeit in die genannten Freiheitsrechte verbundenen Eingriffs in die Grundrechte des Rechtsdienstleisters setzt einmal voraus, dass er gem. Art. 12 I 2 GG oder Art. 2 I GG auf einer wirksamen gesetzlichen Grundlage beruht. Davon ist beim RDG nach bisher h.A.[157] auszugehen.[158]
110
Materiell – hier liegt die eigentliche Problematik – sind Eingriffe in die Berufsausübungsfreiheit wiederum nur zulässig, wenn sie durch ausreichende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt werden und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen.[159] Das gewählte Mittel muss geeignet und erforderlich sein, um die Belange des Gemeinwohls zu wahren. Außerdem darf bei der gebotenen – rational nachvollziehbaren[160] – Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der Gründe, die ihn rechtfertigen sollen, die Grenze der Zumutbarkeit nicht überschritten werden.[161]
111
So hat das BVerfG[162] im Erfolgshonorarverbotsfall ausgeführt: „Ein Eingriff in die Berufsfreiheit ist nur dann erforderlich, wenn ein anderes, gleich wirksames, aber die Berufsfreiheit weniger einschränkendes Mittel nicht zur Verfügung steht… Auch soweit die Freiheit der Berufsausübung betroffen ist, dürfen Eingriffe nicht weiter gehen, als es die rechtfertigenden Gemeinwohlbelange erfordern …“
112
Am Maßstab dieser Kriterien ist in den konkreten Einzelfallen sorgfältig zu prüfen, ob die Annahme eines Erlaubnisvorbehalts – vor allem nach den §§ 2, 3, 5 RDG– verfassungskonform ist.
cc) Fragwürdige Gemeinwohlrelevanz
113
Dabei ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Gemeinwohlerforderlichkeit des Bestehens eines Erlaubnisvorbehalts nach den §§ 2, 3 RDGnur schwer begründet werden kann. Zwar sind die mit § 1 I 2 RDGverbundenen Ziele gemeinwohlrelevant: „ Es dient dazu, die Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen.“ Wie oben dargelegt.[163] sind jedoch bereits erhebliche Bedenken angebracht im Hinblick auf die Erforderlichkeit des Gesetzes, weil es insoweit an einer sorgfältigen empirischen Prüfung fehlt.
114
Die in jedem Fall nur anzuerkennende geringe Gemeinwohlrelevanz wird – was bisher weitgehend verkannt wird – dadurch abgeschwächt, dass der Rechtsuchende die Rechtsdienstleistung selbst erbringen kann.[164] Dann aber ist Zurückhaltung geboten, wenn man ihm einen Berater aufzwingt mit den §§ 2, 3 RDG, zumal damit deutlich wird, dass dem Schutz des Rechtsverkehrs und der Rechtsordnung in § 1 I 2nur eine sekundäre Bedeutung zukommt. Wenn ihm die Autonomie eingeräumt wird, die Dienstleistung selbst zu erbringen, dann sollte man sie ihm erst recht einräumen im Hinblick auf das „Ob“ und „Wie“ bei der Beraterwahl. Dies gebieten auch – dazu unten[165] – die bisher weitgehend negierten Grundrechte der Rechtsuchenden, welche wie z. B. Art. 2 I GG oder Art. 12 I GG bei der Prüfung der Verfassungskonformität zu berücksichtigen sind.
115
Die mehr als abgeschwächte Gemeinwohlrelevanz des RDG wird von der Rechtsprechung auch selbst indirekt z. T. eingeräumt. So geht sie zwar gem. § 134 BGB grundsätzlich davon aus, dass gegen §§ 2, 3verstoßenden Vereinbarungen und Vollmachten nichtig sind. Man schwächt diese Wertung bzgl. der Vollmachten jedoch u. a. entscheidend dadurch ab, dass – z. B. in der Treuhandjudikatur – auf die Grundsätze der Anscheins- und Duldungsvollmacht bzw. des § 242 BGB zurückgegriffen wird.[166]
3. Grundrechte der Rechtsuchenden
116
Bisher weitgehend in verfassungswidriger Weise vernachlässigt wurden wie oben angedeutet in der Rechtsprechung bei der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Erlaubnisvorbehalts des RDG die Grundrechte der Rechtsuchenden.
117
Als Beispiel sei nur die Entscheidung des BSG[167] zur Vertretung von Steuerberatern in sozialrechtlichen Statusfeststellungsentscheidung genannt, wenn es die fatalen Auswirkungen seiner Verneinung einer Vertretungsbefugnis im Widerspruchsverfahren auszublenden versuchte:
118
„Für eine Prüfung am Maßstab der allgemeinen Handlungsfreiheit besteht daneben – soweit es den Kläger betrifft – kein Raum, weil Art 2 Abs 1 GG gegenüber Art 12 Abs 1 GG subsidiär ist (BVerfG Beschluss vom 21.6.2011 – 1 BvR 2930/10 – NZS 2012, 102 RdNr 25 mwN). Auf mögliche Grundrechtspositionen seines Mandanten kann sich der Kläger nicht berufen.“
119
Überzeugender als dieser Rechtfertigungsversuch des BSG war es demgegenüber, dass das BVerfG die Verfassungswidrigkeit des früheren Totalverbots eines Erfolgshonorars damit begründet hat, dass es auf dessen oftmals unzumutbare Folgen für die Grundrechte der Mandanten verwies, denen letztlich Rechtsschutz und anwaltliche Hilfe versagt würden[168]:
120
„Dieses strikte, ausnahmslose Verbot einer erfolgsbasierten Vergütung beeinträchtigt nicht nur die Vertragsfreiheit der Rechtsanwälte und ihrer Auftraggeber, es führt auf Grund seines umfassenden Geltungsanspruchs vielmehr auch zu nachteiligen Folgen für die Wahrnehmung und Durchsetzung der Rechte des Einzelnen … Für die Wahrnehmung und Durchsetzung von Rechten ist es im Rechtsstaat aus Gründen der Chancen- und Waffengleichheit von maßgeblicher Bedeutung, dass sich der Einzelne der Unterstützung durch Rechtsanwälte versichern kann (vgl. BVerfGE 110, 226 <252> m. w. N.). … Nicht wenige Betroffene werden das Kostenrisiko auf Grund verständiger Erwägungen scheuen und daher von der Verfolgung ihrer Rechte absehen. Für diese Rechtsuchenden ist das Bedürfnis anzuerkennen, das geschilderte Risiko durch Vereinbarung einer erfolgsbasierten Vergütung zumindest teilweise auf den vertretenden Rechtsanwalt zu verlagern. Anders als der einzelne Rechtsuchende ist er auf Grund der Vielzahl der Mandate zur Diversifikation der Kostenrisiken in der Lage und kann nicht zuletzt deshalb diese besser tragen. … Vor diesem Hintergrund erweist sich das Verbot anwaltlicher Erfolgshonorare als Hindernis für den Zugang zum Recht… Der Gesetzgeber verfehlt hier nicht nur sein Ziel, durch das Verbot des Erfolgshonorars insbesondere die anwaltliche Unabhängigkeit sowie das Vertrauensverhältnis zum Anwalt zu sichern und auf diese Weise auch im Interesse der Rechtsuchenden einen Beitrag zur Funktionsfähigkeit der Rechtspflege zu leisten. Das Verbot bewirkt vielmehr den gegenteiligen Effekt, indem es den Einzelnen daran hindert, die ihm garantierte Vertragsfreiheit wahrzunehmen und eine Vereinbarung abzuschließen, die ihm bei verständiger Einschätzung der Kostenrisiken die Inanspruchnahme von Rechtsschutz erst eröffnet. Die Unzulässigkeit anwaltlicher Erfolgshonorare fördert hier nicht die Rechtsschutzgewährung, sondern erschwert den Weg zu ihr. Der Gesetzgeber hat nicht beachtet, dass auch eine an sich gerechtfertigte Regelung nicht so gestaltet werden darf, dass sie in ihren tatsächlichen Auswirkungen tendenziell dazu führt, Rechtsschutz vornehmlich nach Maßgabe wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu eröffnen …“ Angesichts dieser ungünstigen Auswirkungen für die Interessen der Allgemeinheit wird das Gewicht der Vorteile eines ausnahmslosen Verbotes so weit gemindert, dass nicht in jedem Fall ein angemessenes Verhältnis gegenüber dem Maß der Belastung der einzelnen Rechtsanwälte besteht. Der Eingriff in die grundrechtlich geschützte Berufsfreiheit der Rechtsanwälte verletzt in dieser Hinsicht das Übermaßverbot.“
Читать дальше