73
Daher bleibt es dem Verantwortlichen, der nachweist, dass er zur Identifizierung nicht in der Lage ist, unbenommen, den Antrag der betroffenen Person nicht stattzugeben. Der Wortlaut des Abs. 6(„unbeschadet“) stellt in diesem Kontext klar, dass der Verantwortliche zwar zusätzliche Informationen zur Identitätsfeststellung anfordern kann[122]. Dem Wortlaut nach gilt dies allerdings nur für die Rechte des Betroffenennach den Art. 15–21. Anders als Abs. 2 S. 1ist hingegen Art. 22nicht erfasst. Dies hätte zur Folge, dass der Verantwortliche im Falle eines Widerspruchs nach Art. 22zwar nicht ohne Identitätsnachweis zum Tätigwerden verpflichtet wäre. Da Art. 22aber dem Wortlaut nach von Abs. 6nicht erfasst ist, müsste der Verantwortliche jeden noch so unglaubhaften Identitätsnachweis akzeptieren. Dass dies so gewollt ist, erscheint unwahrscheinlich. Vielmehr scheint es sich bei der Bezugnahme in Abs. 6um ein Redaktionsversehen zu handeln[123].
IX. Bildsymbole ( Abs. 7)
74
Der Transparenzgrundsatz des Abs. 1ist nicht auf den Einsatz sprachlicher Kommunikation beschränkt.[124] Vielmehr räumt Abs. 7dem Verantwortlichen die Möglichkeit ein, die Informationen der Art. 13und 14mit Hilfe standardisierter Bildsymbole zu erbringen, um auf diese Weise eine verständliche und nachvollziehbare Information zu fördern bzw. zu ermöglichen[125]. Im urheberrechtlichen Kontext haben sich bereits die sog. Creative Commons (CC)-Lizenzen, welche bereits auf das Instrument der Informationsvisualisierung zurückgreifen, als Mittel einer effizienten Informationsvermittlung bewährt. Ihren Erfolg ist es maßgeblich geschuldet, dass der europäische Gesetzgeber standardisierte Bildsymbole nun auch im Bereich des Datenschutzrechts ausdrücklich vorgesehen hat.[126] Wie dem Wortlaut des S. 1 zu entnehmen ist („können“), handelt es sich hierbei jedoch um keine Pflicht des Verantwortlichen. Denn der Einsatz von Bildsymbolen soll nach der Vorstellung des Verordnungsgebers die Informationen nach Art. 13und 14nicht vollständig ersetzen, sondern lediglich ergänzen.[127] Die Regelung soll damit dazu beitragen, den potenziellen Widerspruch zwischen präziser und zugleich verständlicher Information nach Abs. 1aufzulösen und einer Informationsüberlastung der betroffenen Person, die durch die zunehmende Informationsmenge und -komplexität stetig voranschreitet, entgegenzutreten.
75
Nicht sämtliche Informationen sind auch zur Visualisierung tatsächlich geeignet. Zudem sollten Bildsymbole, sofern sie eingesetzt werden, ohnehin zahlenmäßig begrenzt werden, da sie nur dann ihre aktivierende und informationsvermittelnde Wirkung effektiv entfalten können.[128] Insgesamt sollten daher nur diejenigen Informationen visualisiert werden, die sich hierfür tatsächlich eignen und für den Betroffenen eine besondere Relevanz aufweisen. So werden bspw. der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen auch weiterhin individuell zu nennen sein. Ebenso erscheint eine visuelle Darstellung der Rechtsgrundlagen nicht zielführend und brächte den Betroffenen wohl auch keinen wirklichen Mehrwert.[129] Dagegen ließen sich die Zwecke der Verarbeitung, wie etwa personalisierte Werbung oder Profiling, sinnvoll abbilden. Auch die Art der verarbeiteten Daten, z.B. anonymisierte Daten oder besondere Kategorien personenbezogener Daten lassen sich auf diese Weise einprägsam abbilden.[130] Hier könnte bspw. auf Signalfarben wie rot, gelb und grün zurückgegriffen werden, um den Betroffenen die Sensibilität der jeweiligen Datenverarbeitung anschaulich zu verdeutlichen.[131]
76
Die Symbole müssen standardisiertsein. Dies ist einerseits zweckmäßig, denn nur bei einheitlicher und klarer Bildsprache können Symbole die Verständlichkeit fördern. Ob es andererseits gelingen wird, einen sowohl universell verständlichen als auch in der Praxis tauglichen Symbolsatz im Rahmen eines formalisierten Prozesses zu entwickeln, bleibt abzuwarten. Allerdings ist die Verwendung nicht standardisierter Bildsymbole unter Art. 12nicht ausgeschlossen. Diese fallen dann jedoch nicht unter die Privilegierung aus Abs. 7, sondern können als Bestandteil einer verständlichen Information nach Abs. 1eingesetzt werden.
77
Die Symbole müssen maschinenlesbarsein, um zu gewährleisten, dass sie für den Betroffenen ohne weiteres einsehbar sind. Was unter dem Begriff „maschinenlesbar“ zu verstehen ist, wird in der DS-GVO nicht näher erörtert. Um den Begriff genauer zu bestimmen, lässt sich aber auf ErwG 21 der Richtlinie 2013/37/EU zurückgreifen.[132] Hiernach ist ein Dokument dann maschinenlesbar, wenn es in einem Dateiformat vorliegt, das so strukturiert ist, dass Softwareanwendungen die konkreten Daten einfach identifizieren, erkennen und extrahieren können. Dies kann einerseits dadurch umgesetzt werden, dass die Grafiken selbst einfache Formen verwenden, die durch automatisierte Grafikerkennungssysteme erkannt und klar voneinander abgegrenzt werden können. Andererseits kann dies auch bedeuten, dass die Grafiken mit entsprechenden Meta-Daten zu versehen sind, die automatisch auslesbar sind.
78
Aktuell gibt es noch keinen anerkannten standardisierten Symbolsatz i.S.v. Abs. 7. Derweil werden die standardisierten Bildsymbole jedoch auch in anderen Verbraucherschutzbereichen diskutiert[133].
X. Ermächtigung der Kommission ( Abs. 8)
79
Der Kommission wurde die Befugnis übertragen, Verfahren für die Bereitstellung standardisierter Bildsymbole i.S.d. Abs. 7zu entwickeln und die Informationen festzulegen, zu denen die Bildsymbole korrespondieren sollen. Damit wurde der ursprüngliche Ansatz aufgegeben, diese Bildsymbole bereits in der Verordnung selbst festzulegen. Stattdessen überträgt Abs. 8in Verbindung mit Art. 92 Abs. 2 diese Befugnis der Europäischen Kommission.
80
Die Kommission kann danach die Verwendung bestimmter Bildsymbole für bestimmte Informationen – ggf. auch nur für bestimmte Situationen oder bestimmte Verantwortliche – verbindlich anordnen[134].
81
Aufgrund der verordnungsunmittelbaren Wirkung kann von der Rahmenregelung des Art. 12nur abgewichen werden, sofern der nationale Gesetzgeber im Rahmen der Öffnungsklauseln von seiner Gestaltungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat. Für Art. 12findet sich die maßgebliche Öffnungsklausel in Art. 23mit einem abschließenden Katalog, wann eine solche Beschränkung zulässig ist. Faktisch besteht bezüglich Art. 12jedoch nur geringer Regelungsspielraum[135]. Denn sofern bestimmte Betroffenenrechte nicht auch materiell beschränkt werden, werden sich kaum Gründe dafür finden lassen, die bei der prozeduralen Rahmenregelung selbst ansetzen[136]. Daneben kann der nationale Gesetzgeber nach Art. 85 Abs. 2 für eine Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, unter anderen Abweichungen oder Ausnahmen des Kapitels III vorsehen.
82
Das BDSG sieht bisher keine (unmittelbaren) Modifikationenbzgl. der Rahmenregelung des Art. 12vor. §§ 32 Abs. 2 und 33 Abs. 2 enthalten zwar keinen Verweis, übernehmen aber i.E. wortgleich die Anforderungen des Art. 12 Abs. 1für die öffentliche Bereitstellung der Informationen. Nationale Regelungen haben daher nur insoweit (mittelbare) Auswirkungen auf Art. 12, als dass die Informations- oder Mitteilungspflicht als Ganzes entfällt. Dies betrifft etwa § 86 Abs. 2 BDSG n.F. der die Betroffenenrechte der Art. 13–16, 19und 21für unanwendbar erklärt, soweit die Verarbeitung ausschließlich zur Vorbereitung und Durchführung staatlicher Verfahren bei Auszeichnungen und Ehrungen ohne Kenntnis des Betroffenen erfolgt. Daneben haben die aus kompetenzrechtlichen Gründen zuständigen Landesparlamente von der Öffnungsklausel des Art. 85 Abs. 2 Gebrauch gemacht und in den §§ 9c, 57 RStV sowie Landespressegesetzen weitreichende, auch die Betroffenenrechte betreffende Ausnahmen von den Vorgaben der DS-GVO vorgesehen.[137]
Читать дальше
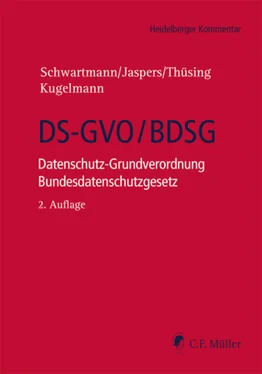


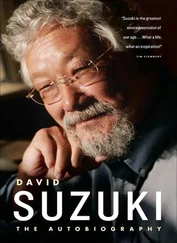
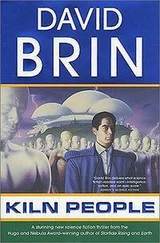



![David Jagusson - Fesselspiele mit Meister David [Hardcore BDSM]](/books/486693/david-jagusson-fesselspiele-mit-meister-david-har-thumb.webp)



