27
Transparenzist ein Überbegriff für die Gesamtgestaltung und setzt voraus, dass der Inhalt an sich erkennbar ist und die wesentlichen Aussagen nicht verschleiert werden.[32] Auch bei diesem Merkmal geht es letztlich um eine Gestaltung der Information, die diese durchschaubar und damit nachvollziehbar macht und die die wesentlichen Aussagen deutlich zu Tage treten lässt. Ferner sollten sich bereitgestellte Informationen von anderen nicht-datenschutzrechtlich relevanten Informationen eindeutig abgrenzen lassen.[33]
28
Leicht zugänglichist die Information, wenn der Empfänger die Mitteilung selbst sowie ihren Inhalt mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen kann, ohne dass zusätzliche Hürden errichtet werden[34]. Dabei ist auch die Barrierefreiheit[35] des Zugangs zu berücksichtigen, sowohl hinsichtlich verwendeter Dateiformate als auch bei farblichen Gestaltungen[36]. Die Informationen müssen damit so ausgestaltet und platziert sein, dass die betroffene Person diese ohne großen Aufwand und ohne wesentliche Zwischenschritte erreichen oder abrufen kann.[37] Die Information darf zudem nicht verdeckt platziert werden[38]. Dies umfasst, insbesondere im Internet, eine aussagekräftige Benennung der Dokumente, in denen die Informationen enthalten sind[39], bspw. der Datenschutzerklärung oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten, insbesondere bei mobilen Endgeräten und embedded Systems, werden hinreichend klare und übliche Piktogramme jedoch ebenfalls ausreichend sein. Insgesamt sollte die Information dem Betroffenen in einem aktiven Kommunikationsprozess vermittelt werden, bspw. im Rahmen einer kontextabhängigen Einblendung oder geeigneter Verlinkung aller vorgeschriebenen Informationen.[40] Werden die Informationen schriftlich übermittelt, so umfasst dies in erster Linie die physische Zugänglichkeit und Lesbarkeit[41]. Maßgeblich ist dabei der Gesamteindruck. So wird etwa allein eine vergleichsweise kleine Schrift je nach angesprochenen Verkehrskreisen nicht zwingend dazu führen, dass keine leichte Zugänglichkeit vorliegt.
29
Eine klare und einfache Sprachesetzt voraus, dass der Kern der Information offen liegt und ohne Schwierigkeiten wahrnehmbar und verständlich ist[42]. Es besteht damit ein enger Zusammenhang zu dem Verständlichkeitsgebot, denn es soll die Verständlichkeit durch eine eindeutige und übersichtliche Formulierung gefördert werden. Dies erfordert eine eindeutige, soweit möglich nicht interpretationsoffene Formulierung[43]. Auf relativierende und interpretationsoffene Begriffe wie „kann“, „könnte“, „dürfte“, „einige“, „oft“, „möglich“ sollte daher verzichtet werden.[44] Vielmehr muss die betroffene Person absehen können, unter welchen Umständen welche Daten zu welchen Zwecken über sie verarbeitet werden. Einfachheit setzt zudem die Verwendung allgemein gebräuchlicher Worte und kurzer Sätze, deren Satzbau und Wortwahl[45] verständlich sind, voraus. Fachbegriffe müssen je nach Adressatenkreis ggf. erläutert werden, bspw. durch weiterführende Links zu ausführlichen Erklärungen. Auch hier besteht ein Spannungsverhältnis zu der Anforderung einer präzisen Information, sodass die Anforderungen an eine klare und einfache Sprache nicht zu hoch gestellt werden dürfen, um Widersprüche zwischen Präzision und Verständlichkeit in einen angemessenen Ausgleich zu bringen.
30
In welcher Sprachedie Information zu erfolgen hat, geht dagegen aus Abs. 1 S. 1nicht explizit hervor. Dies bestimmt sich vielmehr danach, an wen die Information gerichtet ist, d.h. in welchen Staaten der Verantwortliche seine Leistungen anbietet (Marktortprinzip, vgl. Art. 3 Rn. 9 ff.und 25 ff.)[46]. Stärkster Indikator wird dabei sein, in welcher Sprache der Verantwortliche seine übrigen Leistungen erbringt. Bietet bspw. ein Anbieter seine Leistungen ausschließlich in englischer Sprache an, wird die Information nach Abs. 1 S. 1auch in englischer Sprache ausreichen[47].
31
Der Maßstab, an dem die Einhaltung der oben genannten Anforderungen auszurichten ist, kann nicht allgemein bestimmt werden, sondern hängt maßgeblich von dem Durchschnittsadressatender Mitteilung ab[48]. Dieser muss den Inhalt der Mitteilung ohne großen Aufwand erfassen können[49]. Dieser adressatenorientierte Maßstab gilt nicht nur für an Kindergerichtete Informationen, auch wenn ihm in diesem Fall besonderes Gewicht zukommt, sondern generell, wie sich aus dem Wortlaut „insbesondere“[50] gegenüber Kindern ergibt[51]
32
Aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit von Kindern verlangt ErwG 58 S. 4, dass Informationen und Hinweise in einer klaren und einfachen Sprache darzustellen sind, sodass ein Kind diese ohne Probleme verstehen kann.[52] Dies gilt auch dann, wenn dem Kind die datenschutzrechtliche Einwilligungsmündigkeit i.S.d. Art. 8 Abs. 1fehlt.[53] Eine entsprechende Ausgestaltung ist allerdings nicht bei sämtlichen Informationen und Mitteilungen, die den Betroffenen bereitgestellt werden müssen, erforderlich. Vielmehr besteht das Erfordernis einer kindgerechten Sprache lediglich dann, wenn sich das Angebot nach Inhalt und Ausgestaltung speziell an Kinder richtet.[54] Als Orientierungsmaßstab für eine kindgerechte Ausgestaltung komplexer Texte empfiehlt die Art.-29-Datenschutzgruppe beispielhaft die Broschüre[55] „UNICEF-Konvention über die Rechte des Kindes für Kinder erklärt“.[56]
33
Aufgrund der möglichen Bandbreite unterschiedlicher Informationsempfänger sollten Gruppen[57] gebildet werden, bei denen die Anforderungen an die formale und inhaltliche Darstellung je variieren. Denn eine Anpassung und individuelle Formulierung für jeden einzelnen Adressaten dürfte die Grenzen des Möglichen und Zumutbaren sprengen[58], während eine allgemeingültige Formulierung, die den Anforderungen des Art. 12für alle erdenklichen Adressaten genügt, schwer zu finden sein dürfte.
34
Die Formvorschrift in S. 2und 3gilt für Informationspflichten, die keinen Antrag voraussetzen. Soweit ein Antrag erforderlich ist, wird die Regelung jedenfalls teilweise von der Spezialregelung in Abs. 3 S. 4überlagert[59].
35
Gemäß S. 2sind die Informationen „ schriftlich oder in anderer Form“ zu erteilen. Es gelten die §§ 126 ff. BGB entsprechend[60]. Damit ist kein Vorrang einer bestimmten Form gemeint. Dem Verantwortlichen wird vielmehr ein Wahlrecht eingeräumt, in welcher Form er Informationen übermitteln will[61]. Die gewählte Form muss lediglich eine hinreichende Möglichkeit der Kenntnisnahme vermitteln[62].
36
„Gegebenenfalls“ ist auch eine elektronischeInformationserteilung möglich. Diese etwas missverständliche Formulierung beinhaltet jedoch keinen Vorrang der Schriftform[63]. Dies ergibt sich aus ErwG 58 ( S. 2und 3), wonach die Information elektronisch erteilt werden kann. Explizit als Beispiel benannt ist die Veröffentlichung auf einer Webseite. Die elektronische Form steht somit neben der Schriftform und kann von dem Verantwortlichen frei gewählt werden. In Bezug auf Websites ist zudem die Verwendung von mehrschichtigen Datenschutzerklärungen möglich, um für die betroffenen Personen die bereitzustellenden Informationen möglichst verständlich aufzubereiten.[64] Außerdem sollten zusätzliche Mittel berücksichtigt werden, sofern das Gerät, welches die personenbezogenen Daten umfasst, nicht über einen Bildschirm verfügt. Hier könnten etwa die Angabe eines QR-Codes oder der Internet-Adresse in Betracht gezogen werden, unter der man die Datenschutzerklärung auffinden kann.[65] Die Art.-29-Datenschutzgruppe weist ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, die Information je nach Situation zusätzlich auch mündlichgewähren zu können. In Betracht kommen dürfte etwa bei mündlichen Datenerhebungen, etwa am Telefon, mündlich auf den Umstand der Datenerhebung hinzuweisen, um wegen der Details der Information auf eine Homepage, E-Mail oder auf Anforderung auch eine schriftliche Information zu verweisen.
Читать дальше
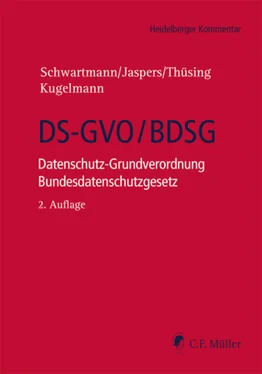


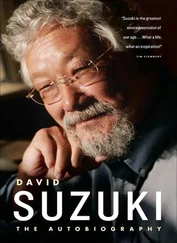
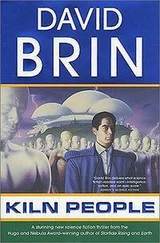



![David Jagusson - Fesselspiele mit Meister David [Hardcore BDSM]](/books/486693/david-jagusson-fesselspiele-mit-meister-david-har-thumb.webp)



