1. Anwendbarkeit des Telekommunikationsgesetzes
54
So gehen weite Teile des Telekommunikationsgesetzes, die auf die ePrivacy-RL zurückgehen, der DS-GVO vor.
55
Damit gehen die Sondervorschriften zum Telekommunikationsdatenschutz nach der ePrivacy-RL nach allgemeinem Verständnis dann den Vorschriften der DS-GVO vor, sofern sie „dasselbe Ziel verfolgen.“ In der Konsequenz bleiben diejenigen Vorschriften auch des deutschen Rechtes anwendbar, soweit sie auf entsprechenden Vorschriften der ePrivacy-RL für öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen beruhen.
56
Dies sind, bezogen auf das TKG, insbesondere die §§ 91 ff. TKG.[40] Soweit §§ 91 ff. TKG Regelungen auch für Anbieter nicht öffentlich zugänglicher Kommunikationsdienste enthält, beruhen diese nicht auf der ePrivacy-RL, so dass insoweit wieder die DS-GVO gilt.[41] Sofern aber zu den Anbietern nichtöffentlicher Kommunikationsdienste öffentliche Stellen gehören, können diese wiederum nach Art. 6 Abs. 1, 2und 3von der Geltung der DS-GVO ausgenommen werden.
2. Anwendbarkeit des Telemediengesetzes
57
§§ 11 ff. TMG enthalten bereichsspezifische Datenschutzregelungen für Telemediendienste, also für Informations- und Kommunikationsdienste, die vornehmlich über das Internet angeboten werden. Die Vorschriften des Telemediengesetzes beruhen nur ausnahmsweise auf der ePrivacy-RL und verdrängen daher regelmäßig die Anwendbarkeit der DS-GVO nicht.[42] Allerdings können die Mitgliedstaaten gem. Art. 6 Abs. 2, 3Öffnungsklauseln zugunsten öffentlicher Stellen formulieren, so dass dann wiederum die Vorschriften des TMG auf entsprechende Dienste, die durch Behörden oder Beliehene – vgl. insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. c[43] – erbracht werden, anwendbar bleiben. [44] Zugleich kann das TMG speziellere Vorschriften gegenüber dem BDSG n.F. enthalten. So geht nach der Rechtsprechung des BGH § 14 Abs. 3–5 TMG § 24 Abs. 1 BDSGvor.[45]
VII. § 1 BDSG n.F. Anwendungsbereich des Gesetzes
58
§ 1 BDSGbeschreibt den sachlichen Anwendungsbereich des BDSG in Ansehung der DS-GVO. Er nimmt dabei die Begrifflichkeit der DS-GVO auf und beschreibt zugleich die Abgrenzung zu den unmittelbar geltenden Normen des EU-Datenschutzrechts.
59
§ 1 Abs. 1 BDSGbeschreibt die Normadressaten bezogen auf öffentliche und nichtöffentliche Stellen.
a) Öffentliche Stellen des Bundes und der Länder als Normadressaten
60
§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 dient der Abgrenzung der Geltung des BDSG für öffentliche Stellen des Bundes und der Länder. Einbezogen sind gem. § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 zunächst die öffentlichen Stellen des Bundes, die wie bislang in § 2 Abs. 1 definiert werden. Demnach sind öffentliche Stellen des Bundes die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform, einschließlich der aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, soweit ihnen Ausschließlichkeitsrechte zustehen. Damit sind alle Ebenen der öffentlich-rechtlichen Tätigkeit des Bundes erfasst, sowohl im Bereich der unmittelbaren wie der mittelbaren Staatsverwaltung.[46]
61
Die Einbeziehung der öffentlichen Stellen der Länder, die in § 2 Abs. 2 definiert sind als „die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform“, sind über § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 einbezogen, soweit nicht vorrangiges Landesrecht gilt, und soweit Bundesrecht ausgeführt wird (lit. a) oder die betreffenden Stellen als Organe der Rechtspflege tätig sind und es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt (lit. b). Aufgrund der Existenz von Landesdatenschutzgesetzen in allen Ländern ist die betreffende Vorschrift weithin gegenstandslos, allerdings gelten Vorschriften des BDSG in den Ländern jedenfalls, soweit das Landesdatenschutzrecht keine eigene Regelung enthält.[47]
62
Allerdings steht es den Ländern nicht frei, diejenigen Stellen des Landes, die nicht Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, von der Geltung des BDSG auszunehmen.
63
Über § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 lit. b sind die Organe der Rechtspflege, soweit sie nicht verwaltende Tätigkeiten wahrnehmen, unter dem Vorbehalt der Nichtexistenz vorrangigen Landesrechts in weiterem Umfang der Geltung des BDSG unterworfen.[48] Umfasst sind hier bspw. auch die Staatsanwaltschaften und Strafvollzugsbehörden,[49] sofern sie nicht verwaltende Tätigkeiten ausüben. Rechtsanwälte wiederum sind zwar Organe der Rechtspflege, aber keine des Bundes oder der Länder. Dagegen unterfallen die Notare der Geltung der (Landes-)Datenschutzgesetze.[50]
b) Nichtöffentliche Stellen
64
Für nichtöffentliche Stellen gilt das BDSG, sofern diese ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, sowie nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten vornehmen, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Das BDSG nimmt insoweit die Begrifflichkeit der DS-GVO auf.
65
Nichtöffentliche Stellen sind gem. § 2 Abs. 4 natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter die Abs. 1 bis 3 fallen. In Fällen einer Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben, also einer Beleihung, gelten die genannten nichtöffentlichen Stelle als öffentliche Stellen und unterfallen dann § 1 Abs. 1 S. 1.
66
§ 1 Abs. 1 S. 2 nimmt im Übrigen das Haushaltsprivileg nach Art. 2 Abs. 2 lit. cauf, indem die Norm anordnet, dass das BDSG nicht anwendbar ist, wenn die Verarbeitung durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten erfolgt. Die Regelung entspricht insoweit auch § 1 Abs. 2 Nr. 3 BDSG a.F.
3. Subsidiarität des BDSG
67
Gemäß § 1 Abs. 2 ist das BDSG subsidiär gegenüber spezielleren datenschutzrechtlichen Vorschriften des Bundes. Dies gilt für Rechtvorschriften jeden Ranges, nicht aber für Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, auch wenn diese für allgemeinverbindlich erklärt sind.[51]
Der Vorrang gilt nur, „soweit“ die betreffende Vorschrift vorrangige Regelungen enthält. Das BDSG bekommt damit insoweit eine Funktion als Auffangvorschrift, gegebenenfalls zur Schließung von Gesetzeslücken.[52]
68
Zugleich gehen alle spezialgesetzlich geregelten Geheimhaltungsvorschriften (etwa Sozialgeheimnis, § 35 SGB I, Steuergeheimnis, § 30 AO, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, § 17 UWG) vor. Ausdrücklich angeordnet ist auch die vorrangige Geltung nicht gesetzlich geregelter Geheimhaltungspflichten, wie etwa das Anwaltsgeheimnis und das Patientengeheimnis.
69
Wie bereits unter Geltung des § 1 Abs. 4 BDSG a.F. geht das BDSG entsprechend § 1 Abs. 3 den Vorschriften den VwVfG vor, soweit bei Ermittlung eines Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden.
70
Die Anordnung des § 1 Abs. 4 BDSG a.F. betraf insbesondere das Verhältnis zwischen § 4 Abs. 2 BDSG a.F. und §§ 24, 26 VwVfG bezüglich Amtsermittlungsgrundsatz und Beweismitteln im Verwaltungsverfahren. Hier setzte § 4 Abs. 2 BDSG a.F. voraus, dass die Datenerhebung vorrangig beim Betroffenen stattzufinden hatte,[53] womit der Behörde bezüglich der Datenerhebung bei Dritten erhebliche Grenzen gesetzt wurden.
Читать дальше
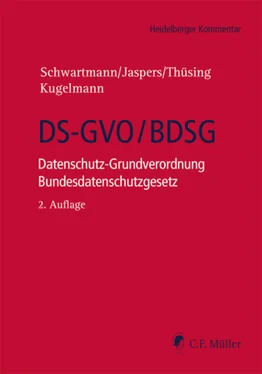


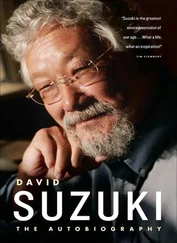
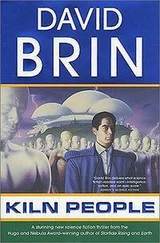



![David Jagusson - Fesselspiele mit Meister David [Hardcore BDSM]](/books/486693/david-jagusson-fesselspiele-mit-meister-david-har-thumb.webp)



