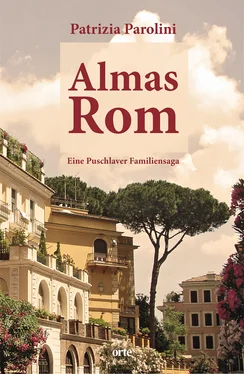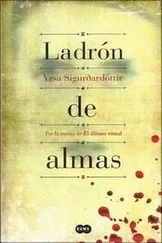Patrizia Parolini
Almas Rom
Patrizia Parolini
Almas Rom
Roman
orte Verlag
Dieser Roman basiert auf wahren Begebenheiten, jedoch sind die Namen der Personen geändert sowie weitere Figuren und die allermeisten Fakten erfunden.
Die Textauszüge stammen aus dem Buch «Nostalgie» von Grazia Deledda.
Sie wurden von der Autorin ins Deutsche übersetzt.

© 2018 by orte Verlag, cH-9103 Schwellbrunn
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Radio und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Janine Durot
Gesetzt in Arno Pro Regular
Satz: Verlagshaus Schwellbrunn
E-Book-Herstellung und Auslieferung:
HEROLD Auslieferung Service GmbH
www.herold-va.de
ISBN 978-3-85830-240-3
ISBN e-Book: 978-3-85830-241-0
www.orteverlag.ch

für Elvira
ROMA
I
Alma brach die Schale auseinander. Ihre Finger brannten. Sie roch den rauchigen Duft der gerösteten Kastanie und hörte die ciociari – die Bauersleute aus der Ciociaria –, wie sie unter den Arkaden entlang der Piazza weiter riefen: «Calde e arroste, calde e arroste! – Heisse Marroni, heisse Marroni!»
Es war ein kalter Januartag im Jahr 1901. Die Verkäufer sassen eingehüllt in abgetragene Jacken und dicke Decken hinter ihren Röstöfen, neben Körben voller Edelkastanien und aufgeschichteten Holzscheiten für das Feuer. Alma trug ihren rostroten Wollmantel und die weisse Strickmütze, unter der ein zartes, blasses Gesicht mit schmalen Augen und dunkelbraune, gewellte Haare hervorschauten. Während sie auf die Kastanie in ihrer Hand pustete, schaute sie zu, wie der ciociaro vor ihr seinen Atem in die Hände hauchte, um sich zu wärmen. Es waren grosse, abgearbeitete Hände mit russigen Fingern.
Anna, die Mutter, hatte Alma vom Institut an der Via Buonarroti und Romeo von der Sonderschule an der Piazza Pepe abgeholt. Sie hatte die centesimi abgezählt, die Tüte entgegengenommen und die caldarroste an ihre Kinder verteilt, an Alma, Romeo und die kleine Amelia. Neben ihr stand der Kinderwagen, in dem Attilio schlief, das fünf Monate alte Brüderchen. Alma kratzte das haften gebliebene Stück dünne, haarige Haut von der Frucht und steckte diese in den Mund. Mehlig zerfiel das Fruchtfleisch auf ihrer Zunge.
«Meine grosse Schwester hatte gestern Geburtstag!», platzte Romeo voller Stolz heraus.
«Wie alt bist du denn geworden?», brummte der Mann mit dem gegerbten Gesicht, musterte Romeo und fuhr mit der Kelle durch die Kastanien in der Röstpfanne.
«Sieben!», antwortete Alma schüchtern.
Die kleine Amelia stellte sich selbstbewusst vor den Verkäufer hin und streckte ihm drei Finger entgegen: «Tre!»
«Hmm! Kommt her!» Mit seiner Kelle legte er jedem der Kinder eine zusätzliche Kastanie in die Hand. «Ihr müsst blasen, sie sind sehr heiss!»
«Danke!», freute sich Alma und liess die Kastanie von einer Hand in die andere rollen, bis sie nicht mehr brannte auf der Haut.
Langsam gingen sie die Via Leopardi hinunter. An der Mündung in die Via Merulana warteten sie, bis die carrozze – die Kutschen – und die von Pferden gezogene Tramway vorbeigerattert waren. Dann überquerten sie die breite Strasse und standen vor der Bar von Vater und zio Edgardo.
II
Kaffeeduft steigt mir in die Nase. Spirituosen stehen auf dem beleuchteten Glasregal an der Wand. Campari, Fernet-Branca, Ramazotti. Mein Blick schweift zur Kasse, zur Vitrine mit den gefüllten cornetti und hinaus zu den Tischen auf dem Gehsteig unter dem dichten Blätterdach der ahornblättrigen Platanen. Italienische Popmusik ertönt aus dem Hintergrund. Die Serviererin stellt mir die Tasse hin. Unter dem röstbraunen Schaum ist der Kaffee nachtschwarz. Mit der Hand streiche ich über die grünlich gläserne Theke. Das ist sie also, die Kaffeebar, die einst Cristoforo und Edgardo, meinem Urgrossvater und dessen Bruder gehört hatte. Der Ort in Rom, wo das Leben von Alma, meiner Grossmutter, eine erste dramatische Kehrtwende erfuhr.
Ich sehe mich, das sechsjährige Mädchen mit den Stirnfransen, an Almas Beerdigung – nicht in Rom, sondern im Puschlav. Wie ich auf dem engen Vorplatz stehe, rund um mich herum schwarz gekleidete Menschen, die sich begrüssen, flüstern, sich die Nasen schnäuzen. Und mittendrin stand der Sarg. Ich wusste, etwas Wichtiges war passiert, und ich wollte dabei sein. Doch so sehr ich mich auch gewehrt hatte, ich weiss noch genau, ich hatte nicht mitgehen dürfen.
Vage erinnere ich mich, dass auch die zie aus Rom da gewesen waren, die Nichten von Alma. Sie kamen beinahe jeden Sommer hinauf in das Bergtal und schwärmten immer von der aria genuina – der gesunden Bergluft. Sie waren klein, elegant gekleidet und voller Temperament. Meine Schwestern und ich freuten uns, die drei Tanten zu sehen, denn sie gingen jedes Mal mit uns in das Café an der Piazza. Wir Kinder waren wild auf die gelati, die es dort gab, weil man sie so, frisch in der Waffel, nicht bekam an unserem Wohnort in der Deutschschweiz.
Auch wir verbrachten die Sommerferien im Puschlav und nicht etwa am Meer wie meine Schulkameraden. Deshalb war mir Italien kein Begriff, bis ich zum ersten Mal nach Rom reiste und mich in einer verrückten, verkehrsverstopften Stadt wiederfand. Ich war siebzehn und entsetzt darüber, dass abends, wenn wir uns die Nasen putzten, sich die weissen Taschentücher schwarz färbten. Ich weiss auch noch, wie meine Schwestern und ich auf dem Rücksitz des roten Topolino sassen. Am Steuer die zia. Wir brausten über die Piazza Venezia. Ich staunte über das riesige, blendend weisse Monument. Die Tante nannte es spöttisch die «Schreibmaschine». Später raste sie über eine Kreuzung, obwohl die Ampel bereits auf Rot gesprungen war. Sie wollte die andere Tante und unsere Eltern, die vorausfuhren, im Chaos des römischen Stadtverkehrs auf keinen Fall verlieren. Wir Kinder kreischten, vor Schreck und vor Übermut. Und jetzt, zwanzig Jahre später, bin ich zum zweiten Mal in Rom. An der Piazza Venezia habe ich festgestellt, dass die «Schreibmaschine» anders aussieht als in meiner Erinnerung. Auf dem verkehrsberuhigten Platz ist jetzt ein grasbewachsener Kreisel, Sigthseeingbusse und Reisecars fahren heran, Touristen flanieren auf der autofreien Strasse, die zum Kolosseum führt. Meerkiefern spenden Schatten. Das Vittoriano ist eine gigantische Säulenreihe mit Treppen, Balustraden und Ornamenten und der bronzenen Reiterstatue von König Vittorio Emanuele II in der Mitte. Das Weiss des Marmors hebt sich ab vom Rostrot der anliegenden Palazzi. Nach dem Willen der Erbauer sollte das Denkmal zur Ehre des neuen, geeinten Italiens alle bestehenden Wahrzeichen der Stadt überstrahlen. Heute wirkt es fremd und selbstgefällig.
Mit dem Lift bin ich auf das Dach des Monuments hinaufgefahren, um die Stadt von oben zu sehen. Ein Foto in einem Schaukasten auf der Zwischenterrasse zeigt Szenen der Einweihung: ein schwarzes Meer von gedrängt stehenden Menschen und gehissten Fahnen. Jeder Zwischenraum, jeder Vorsprung und sogar das Dach ist von Feiernden besetzt. Man sieht den klein gewachsenen König Vittorio Emanuele III flankiert von den corazzieri – den gross gewachsenen Soldaten seiner Leibgarde. Ich habe mir vorgestellt, wie die Leute damals, von der Piazza aus, nur den hohen Zylinder sahen, wie er sich hob und senkte mit jeder Stufe, die der König emporstieg, im Takt mit den hin- und herpendelnden Rosshaarschweifen auf den Helmen der Gardisten, und wie deren silbrige Brustpanzer glänzten und die Reitersäbel rasselten. Man hatte die Einweihung des Vittoriano im Jahr 1911 zum Anlass genommen, Cavour, Mazzini und Garibaldi und das fünzigjährige Bestehen des italienischen Nationalstaats zu feiern.
Читать дальше