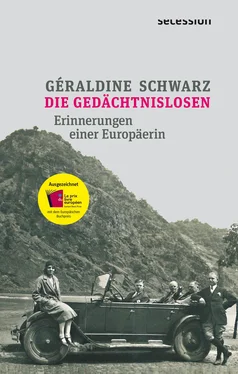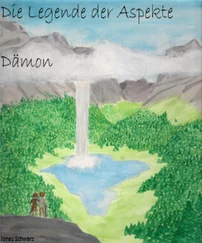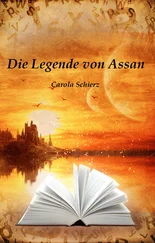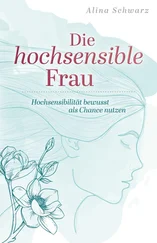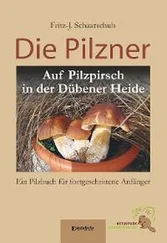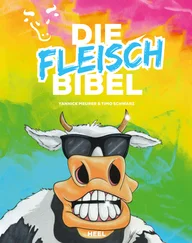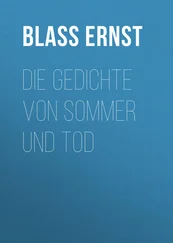Ich muss ihm zumindest ein gewisses Talent zugestehen, das es ihm erspart hat, einer kriminellen Bande megalomaner und suizidaler Nazis als Kanonenfutter zu dienen. Vor Kurzem jedoch, als mein Vater und ich die im Keller gehorteten Ordner durchgingen, schien der Hintergrund von Opas Freistellung plötzlich unter einem anderen Licht auf. In einem auf den 4. März 1946 datierten Brief klagt sein Geschäftspartner der Schwarz & Co. Mineralölgesellschaft, Max Schmidt 1, meinen Großvater an, die Nazi-Obrigkeiten darüber informiert zu haben, dass er, Schmidt, kein Mitglied der NSDAP war, und er damit allein die Absicht verfolgt habe, dass Schmidt an seiner statt zur Armee eingezogen würde. »Ihr damaliger Vorwurf, dass Sie mich wegen meiner Nichtzugehörigkeit zur Partei haftbar machen sollten, ist kein Fantasiegebilde, sondern leider Tatsache gewesen, genau wie Ihre sonstigen Aussagen, die Sie heute nicht mehr wahrhaben wollen. Im Übrigen drehten Sie bisher den Wind stets so, wie es für Ihre eigenen Zwecke günstig war, während ich Ihrerseits nur als das notwendige geldgebende und auftragsbringende Übel angesehen wurde.« Und er fügt hinzu: »Ich bin ja nicht freiwillig Soldat geworden. Durch meine Einziehung zur Wehrmacht wurde Ihnen ja erst die Möglichkeit gegeben, für den Betrieb unabkömmlich gestellt zu werden.«
Bei den Behörden muss mein Großvater geahnt haben, dass, sollte denn überhaupt eine Chance bestanden haben, der Wehrmacht mit der Begründung entkommen zu können, die Firma benötige einen Geschäftsführer, diese dann nur für ihn oder seinen Partner gegolten hätte, keinesfalls aber für beide zugleich. Und gut möglich, dass er eben in diesem Moment und ganz nebenbei hatte durchsickern lassen, dass sein Partner Max Schmidt kein Parteimitglied war.
Vom Frühling 1943 an lebte Karl allein, da Frau und Kinder inzwischen aufs Land gezogen waren. Die Abende müssen ein wenig traurig gewesen sein in dem halb leeren Gebäude auf der Chamissostraße, dessen Einwohner entweder aus der Stadt verbannt oder aber an der Front dem Tod und der Kälte trotzten, abgesehen von drei oder vier Seelen, die in dieser gespenstischen Kulisse diverser Wohnungen zusammenlebten, in deren Decken, Böden und Wänden Risse klafften und deren zerborstene Fenster mithilfe großer Kartonstücke abgedichtet worden waren. Um ein wenig Aufmunterung zu erfahren, begab sich mein Großvater in das Kabarett Eulenspiegel , auf der Langen Rötterstraße, einer kleinen Seitenstraße. Viele Kabaretts, Varietéhäuser und Theater des Dritten Reiches hatten bis zum 1. September 1944 ihren Betrieb fortgeführt, als schließlich Propagandaminister Joseph Goebbels deren Schließung anordnete. Bis dahin waren viele Künstler vom Armeedienst befreit, da ihre Rolle im Wesentlichen darin gesehen wurde, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung von den allgegenwärtigen Schreckensszenarien, in die Hitler sie zu stürzen im Begriffe war, abzulenken.
Das Etablissement existiert nicht mehr, aber ich habe in den Papieren meines Großvaters ein Blatt gefunden, dessen Briefkopf in hübscher roter Kalligrafie den Schriftzug »Eulenspiegel – Parodistisches Kabarett« trägt. Am unteren Seitenrand sind Auszüge positiver Pressestimmen wiedergegeben. Aus Saarbrücken: »Selten wird Kunst in dieser pikanten Form serviert. Mit klassischem und volkstümlichem Gesang paart sich ein schalkhafter Humor, durchweht von sprühendem Geist. Das Ganze als Eulenspiegelparodie war, man kann es nicht anders bezeichnen, eine Glanzleistung.« Aus Mannheim: »Die Eulenspiegel gewannen schnell Sympathie, denn sie zeigten Originalität, Geist und – welch seltene Wohltat – Niveau.« Auf halber Höhe des auf den 2. Februar 1948 datierten Briefes steht geschrieben: »Wir bestätigen hiermit, dass Herr Karl Schwarz zu unserer Gruppe gehört«, und unten auf der Seite bezeugt dies die Unterschrift des Leiters des Kabaretts, Theo Lustfeld 2. Welches Motiv sich auch immer hinter diesem Dokument verbergen mag, das zweifellos als Alibi gedient haben musste, um meinen Großvater nach dem Krieg von möglichen Unregelmäßigkeiten reinzuwaschen, so verweist es doch darauf, dass Karl das Etablissement häufiger aufgesucht haben muss, um ein solch heimliches Einverständnis erlangt haben zu können. Tatsächlich hatte er vor allem mit einer Dame verkehrt, einer Künstlerin, die zugleich die Ehefrau des Chefs war, Frau Lustfeld, und sich dem Paar so sehr angenähert, dass er nach der Zerstörung seiner Firma im September 1943 sein Büro und seine Lagerhalle gleich neben ihrer Wohnung in einer an den Randgebieten von Mannheim gelegenen Ziegelei einrichtete, wo er dann auch bis zum Ende des Krieges wohnte. Und da es kaum vorstellbar ist, dass der Ehemann von der intimen Nähe, die seine Frau an ihren neuen gemeinsamen Freund band, keinen Wind bekommen hatte, hält mein Vater es für durchaus wahrscheinlich, dass sie eine Art Ménage-à-trois führten, die bis zum Tode meines Großvaters halten sollte. Als Oma begriff, dass die Lustfelds, die sich während ihrer Abwesenheit so rührend um ihren Ehemann gekümmert hatten, mehr als nur Freunde waren, stürzte sie dies in einen Schmerz, von dem sie sich nie mehr wirklich erholen sollte. Glücklicherweise hat sie diese unangenehme Entdeckung erst sehr viel später gemacht und nicht schon nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 bei ihrer Rückkehr mit den Kindern nach Mannheim. Ein anderer Schock erwartete sie dort bereits: Die Stadt, in der sie das Licht der Welt erblickt hatte, war zur Hälfte verschwunden.
Mannheim war im Südwesten Deutschlands eine der am meisten zerstörten Städte; 70 Prozent des Zentrums und 50 Prozent der restlichen Stadt lagen in Trümmern. Es hatte den desaströsen Luftangriff vom September 1943 gegeben und zahlreiche weitere, und schließlich flogen die Bomber der Royal Air Force am 2. März 1945 noch ein letztes Mal los, obwohl das Ende des Krieges bereits absehbar war, und entzündeten einen Feuersturm, der den Rest der historischen Altstadt mit sich davontrug. Ende März hatten die Mannheimer bei der Ankunft der Amerikaner die Waffen gestreckt und waren auf diese Weise, ohne es zu wissen, dem Schlimmsten überhaupt entkommen, denn ein amerikanischer Geheimplan sah vor, über mehreren Städten nukleare Sprengbomben niedergehen zu lassen, sollten die Deutschen Widerstand leisten – Mannheim und Ludwigshafen zählten zu den möglichen Zielen.
Falls Oma mit dem Zug angekommen sein sollte, so hat sie neben dem Bahnhof das große Barockschloss, von dessen 500 Zimmern ein einziges unberührt geblieben war, an allen Ecken und Enden durchlöchert gesehen. Um zur Chamissostraße zu gelangen, hat sie die alten großen Einkaufsstraßen überqueren müssen, die einst von prächtig erleuchteten Kaufhäusern gesäumt gewesen waren, vor Leben nur so wimmelnd und jeglichen Überfluss zur Schau stellend – Magnete, in die man aus der ganzen Region herbeigeströmt war, um Einkäufe zu erledigen. Karstadt und die ehemaligen jüdischen, nun aber arisierten Kaufhäuser Kander, Gebrüder Rothschild, Hermann Schmoller & Co waren zum Großteil wie Kartenhäuser unter den Bomben zusammengesackt. Von den Cafés, die im Sommer stets ihre schönen Terrassen geöffnet hatten, um den Damen Sahnetorten und Kaffee zu servieren, war keine einzige Spur mehr verblieben, abgesehen vielleicht von einigen aus ihren Firmenschildern herausgerissenen Buchstaben oder auch den Scherben des Geschirrs, das den Namen des Caféhauses trug und nun als Splitter aus den Trümmerbergen herausragte, die sich an den Gehsteigkanten auftürmten, um den Weg freizugeben. Ganze Straßenzüge waren verschwunden, verwandelt in großflächige, schemenhafte Terrains, auf denen hier und da die Karkassen von Gebäuden und die körperlosen Fassaden fortbestanden, aufgestellt wie Theaterkulissen im Nichts. Ich stelle mir Oma vor, wie sie, eine äußerst gläubige Protestantin, die altvertraute Silhouette einer Kirche mit ihren Blicken sucht und an deren Stelle nichts als das nackte Skelett eines Kirchenschiffs vorfindet und ein vor der klaffenden Öffnung eines Glockenturms schief hängendes Kreuz.
Читать дальше