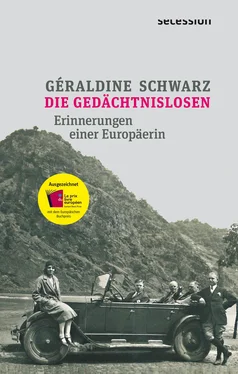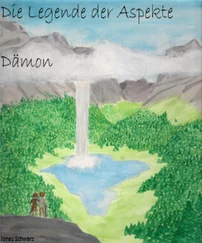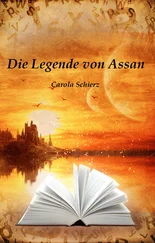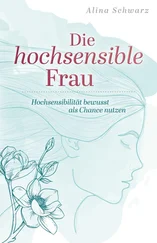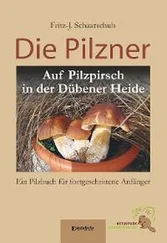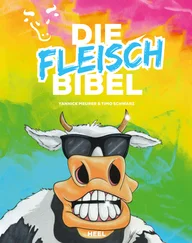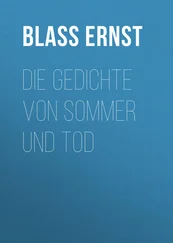Aus Gurs zu fliehen war verhältnismäßig einfach, da dessen Umzäunung nur zwei Meter hoch und weder elektrisiert noch mit Wachtürmen verstärkt war. Dennoch gab es wenige Fluchtversuche, da die größere Herausforderung erst noch folgte: ein langes, angsterfülltes Versteckspiel mit der Polizei. Vermutlich weil ein solcher Ausbruch mit Kindern und älteren Eltern unvorstellbar war, zogen viele Gefangene die Familie der Freiheit vor.
In Gurs hatten religiöse und humanitäre Verbände die Erlaubnis erhalten, Nahrung zu liefern, medizinische Versorgung anzubieten und den Alltag der Inhaftierten zu erleichtern. Eine von ihnen, die internationale jüdische Hilfsorganisation HICEM, half den Juden dabei, die nötigen Unterlagen für die Einreichung einer Emigrationsanfrage zusammenzustellen. Jene, denen dies gelang, baten den Vorsteher des Lagers, nach Marseille, diesem großen französischen Hafen am Mittelmeer, überführt zu werden, hegten sie doch die Hoffnung, sich von dort aus nach Übersee einschiffen zu können. So gelangten im April 1941 schließlich auch Julius und Mathilde Löbmann mit ihrem Sohn Fritz sowie Wilhelm Wertheimer und seine Frau Hedwig mit ihrem Sohn Otto nach Marseille. Dank der Unterstützung der Mitarbeiter aus der Gedenkstätte des Lagers Les Milles, einer der Vorzeigeinstitutionen in Frankreich, um die jungen Generationen für dieses Gedenken zu sensibilisieren, konnte ich den weiteren Weg der Mitglieder dieser Familie nachzeichnen.
Die Männer kamen nach Les Milles, das unter der Verwaltung von Vichy stand und wo zahlreiche Künstler und Intellektuelle wie etwa Golo Mann und Lion Feuchtwanger interniert waren. Die Frauen und Kinder wurden in zu Unterbringungszentren umfunktionierten Hotels in der Innenstadt von Marseille geschickt.
Hedwig und Otto, der damals neun Jahre alt war, wurden ins Hôtel Bompard gebracht, Mathilde und Fritz, damals zwölf Jahre alt, ins Hôtel Terminus les Ports. Man litt an Unterernährung, an Hygienemangel, an Ungeziefer, an mangelnder Kleidung und Kälte in diesen Häusern, in denen die Stromversorgung und das Wasser rationiert waren und deren Besitzer oft nicht die geringsten Skrupel hatten, die vom französischen Staat ausgezahlten Aufwandsentschädigungen in die eigene Tasche zu stecken und nur einen Bruchteil den Gästen zugutekommen zu lassen. Außerdem war man dem Gutdünken widerwärtiger Figuren wie dem Arzt Félix Roche-Imbart ausgesetzt, der seiner sadistischen Lust frönte, die Unterbringung erkrankter Gäste in Hospitälern und Sanatorien zu verhindern und ihnen den Besuch von Ehegatten zu verbieten. Trotz allem waren im Vergleich zum Lager in Gurs die Lebensbedingungen deutlich bessere. Internationale Hilfsorganisationen gaben Kindern Unterricht und richteten für die Mütter Nähkurse ein, vor allem aber konnten die meisten Frauen sich frei in der Stadt bewegen, am Strand spazieren gehen und weiterhin versuchen, die notwendigen Behördenwege zu erledigen, um auswandern zu können.
Laut Archiv des Lagers Les Milles muss Hedwig versucht haben, für ihre Familie amerikanische Visa zu erhalten. Was wahrscheinlich auch für Mathilde gilt. Sie kamen zu spät. Kurz zuvor war ein solches Ziel noch umsetzbar, dank des amerikanischen Vizekonsuls in Marseille, Hiram Bingham IV, der Visa und gefälschte Papiere beschaffte. Oder aufgrund der Hilfe des amerikanischen Journalisten Varian Fry, dem es gemeinsam mit einem großen Netzwerk an Unterstützern gelungen war, mehr als 2.000 Juden aus Frankreich herauszuschleusen, unter denen sich hauptsächlich Künstler, Intellektuelle und Wissenschaftler wie Claude Lévi-Strauss, Max Ernst, Hannah Arendt oder Marc Chagall befanden. Als Reaktion, aber auch auf Druck des Vichy Regimes hin, entzog das Aussenministerium in Washington dem Konsulat die Entscheidungshoheit in Sachen Visavergabe, versetzte Hiram Bingham IV nach Portugal und konfiszierte den Pass von Varian Fry.
Hedwig Wertheimers und Mathilde Löbmanns Bestrebungen zur Emigration scheiterten im Sommer 1942, sie wurden mit ihren Söhnen nach Les Milles überführt, wo sie wieder auf ihre Ehemänner Julius und Wilhelm trafen. Die Stimmung war bedrückend. Im Lager Drancy nördlich von Paris hatten die Deportationen nach Auschwitz begonnen. Offiziell hieß es, um die Häftlinge in Arbeitslager zu bringen. Beim Anblick der Viehwaggons, in die man ganze Familien ohne Wasser einpferchte, fragten sich viele, warum man wohl auch Kinder, die gar nicht befähigt waren zu arbeiten, in die Züge zwängte. Es war auch schon von Massakern die Rede.
Hedwig und Mathilde mussten die Gefahr gerochen haben. Wie andere Mütter auch, entschieden sie sich, ihre Söhne dem jüdischen Kinderhilfswerk anzuvertrauen. Zeugen haben von herzzerreißenden Trennungen berichtet, dem Weinen der Kinder, die man von ihren Müttern trennte, die wiederum damit zu kämpfen hatten, Haltung zu wahren, um ihre Kleinen nicht zu beunruhigen. Otto wurde ins Château de Montintin südlich von Limoges gebracht, wo sich mehrere Hundert Kinder zwischen 12 und 17 Jahren versteckt hielten, unter ihnen vor allem deutsche Juden, die dort von einem Arzt beschützt wurden. Fritz ging in eine ähnliche Anstalt, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Kinder vor der Deportation zu retten.
Im Frühling 1943 hatten die beiden Cousins das Glück, noch einmal in einem der letzten Zufluchtsorte Frankreichs vereint zu sein, der in der damals von Italien besetzten Zone im Südosten Frankreichs lag. In Izieu, einem kleinen, hoch gelegenen Dorf an den Hängen eines Arms der Rhône, hatte die polnisch-jüdische Widerstandskämpferin Sabine Zlatin gemeinsam mit ihrem Ehemann ein Heim errichtet, wo sie die Kinder vor der Deportation bewahren wollte. Zum ersten Mal seit Langem konnten Fritz und Otto wieder an die Leichtigkeit der Kindheit anknüpfen. In der Gedenkstätte von Izieu zeigen Fotos diese Kinder auf einer weiten Wiese, ihr Haar im Wind, als Gruppe vor einem Haus, die Großen tragen die Kleineren auf ihren Armen, in Badehose auf einem Steg an einem See. Sie lächeln fast immer und es ist auf diesen Bildern, die Aufnahmen welcher glücklichen Kindheit auch immer sein könnten, nicht der Hauch eines Vorzeichens zu sehen.
Die italienische Besatzungszone war für Juden die sicherste, da sich die Italiener, im Gegensatz zu den Franzosen, so gut es ging weigerten, sie auszuliefern. Im September 1943 aber, nach der Kapitulation des faschistischen Italiens, kippte die Situation, da nun die Deutschen die italienische Zone in Frankreich besetzten. Die aufkommende Gefahr ahnend, machte sich Sabine Zlatin Anfang April 1944 auf, eine andere Zufluchtsstätte zu finden. Doch während ihrer Abwesenheit geschah es am Morgen des 6. April, dem ersten Tag der Osterferien, als die Kinder gerade dabei waren, ihr Frühstück vorzubereiten, dass zwei Lastwagen der Wehrmacht und ein Dienstwagen der Gestapo die 44 Jungen und Mädchen, den Ehemann von Sabine Zlatin und sechs Erzieher festnahmen und ins Lager von Drancy brachten. Der Befehl dazu stammte vom Leiter der Gestapo in Lyon, Klaus Barbie, einem Mann, der für seine an Wahnsinn grenzende Besessenheit berüchtigt war, Juden und Widerstandskämpfer zu jagen, die er dann mit hemmungsloser Leidenschaft allen möglichen Foltermethoden unterwarf, deren genialer Erfinder er sich zu sein rühmte.
Am 15. April 1944 wurden Fritz Löbmann und Otto Wertheimer, damals 15 und 12 Jahre alt, in einem Konvoi zusammen mit 30 anderen Kindern von Izieu nach Auschwitz deportiert. Am Tag ihrer Ankunft wurden sie vergast.
Zwei Jahre zuvor waren die Eltern von Otto Wertheimer, Hedwig und Wilhelm, und die Mutter von Fritz Löbmann bereits nach Drancy überführt worden. Am 17. August wurden sie mit dem Konvoi Nummer 20 verschleppt. Endstation: Auschwitz. Am 2. September war es dann Siegmund, der nach Drancy kam, er wurde am 7. September mit dem Konvoi Nummer 29 deportiert. Endstation: Auschwitz. Seine Einsamkeit wird seine Notlage nur noch schlimmer gemacht haben. Seine Frau Irma stand auf der Liste der zu Deportierenden des Lagers Les Milles, dürfte aber wohl in letzter Sekunde gerettet worden sein, und dies womöglich von Medizinern, die ihre Notaufnahme im Krankenhaus von Aix-en-Provence verlangten.
Читать дальше