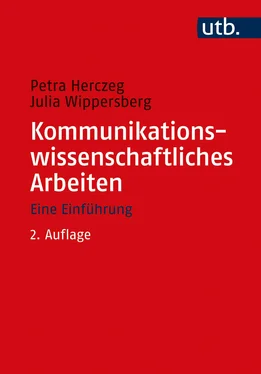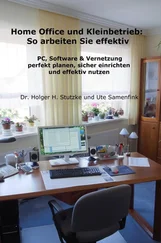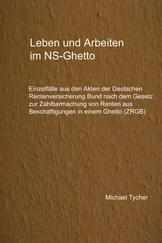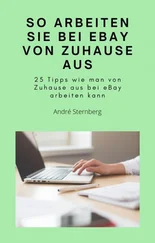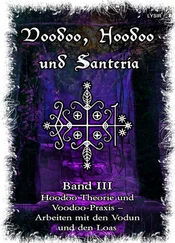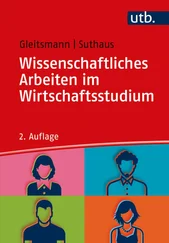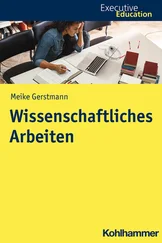Die Allgegenwart medialer Kommunikation ermöglicht vielfältige Beziehungen zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Besonders enge Kooperationsbeziehungen bestehen zu Fächern, mit denen die Kommunikations- und Medienwissenschaft gemeinsame Forschungsfelder oder Studiengänge ausgebildet hat. Beispiele für Forschungsfelder sind Kommunikations- und Medienethik, Kommunikationspolitik, Mediengeschichte, Medienlinguistik, Medienökonomie, Medienpädagogik, Medienpsychologie, Medienrecht, Mediensoziologie und Medientechnologie, politische Kommunikationsforschung und visuelle Kommunikation; von großer Bedeutung ist auch die Kooperation mit der geisteswissenschaftlich orientierten Medienwissenschaft. In allen diesen Bereichen findet ein erfolgreicher Austausch auf theoretischer und empirischer Ebene statt. Die Kommunikations- und Medienwissenschaft greift in Forschung und Lehre gesellschaftliche Wandlungsprozesse auf. Zentrale Stichworte sind hier Digitalisierung, Globalisierung, Individualisierung, Mediatisierung und Ökonomisierung. (DGPuK, 2008)
3.5Generelle wissenschaftstheoretische Positionen mit Fokus auf die Sozialwissenschaften
3.5.1Wissenschaftstheoretische Blitzlichter
Wissenschaftstheorie ist ganz basal formuliert die Wissenschaft von der Wissenschaft in all ihren Ausformungen und Facetten. Wissenschaft bedeutet, dass die Frage nach dem Warum gestellt wird, es ist das systematische und methodische Weiterfragen, und dies seit der klassischen griechischen Antike, der Geburtsstätte „unserer abendländischen rationalen Kultur“ (Poser, 2001, S. 11). Das Aufgabenverständnis der Wissenschaftstheorie kann dahingehend beschrieben werden, dass es um die Aufklärung über Wissenschaft geht, nämlich „über die Bedingungen ihres Funktionierens, ihrer Stagnation, Degeneration und Progression. […] Sie ist keine Metatheorie, keine Überwissenschaft, keine Methodologie a priori“ (Fischer, 1995, S. 254).
Dies führt in weiterer Folge dazu, dass man sich mit Fragen der Erkenntnis auseinandersetzen muss. Denn Wissenschaftstheorie ist immer auch ein Teil der Erkenntnistheorie, auch wenn Fragestellungen nach Erkenntnis viel weiter zurückgehen als Fragen der Wissenschaft selbst. [31]
Das Ziel der Wissenschaft ist es, Erkenntnis zu gewinnen. Wie man zu Erkenntnissen gelangt, wird in der Wissenschaftstheorie intensiv diskutiert, es gibt dazu unterschiedliche Zugänge und Vorstellungen.
Nur um zu illustrieren, wie sich wissenschaftstheoretisches Denken entwickelt hat und wie lange es die Beschäftigung mit derartigen Fragen schon gibt, soll auf die drei großen Denker Griechenlands verwiesen werden: Sokrates, Platon und Aristoteles, wobei „von denen der Jüngere jeweils der Schüler des Älteren war“ (Störig, 1999, S. 137). Diese Zeitspanne (Philosophie der Antike) war prägend für die gesamte philosophische Entwicklung, da sowohl Logik, Metaphysik, Ethik, Natur- und Gesellschaftspolitik, Ästhetik und Pädagogik (vgl. Störig, 1999) ausgebildet wurden. Diese Bereiche bilden das Fundament, auf dem auch heute noch die unterschiedlichen Wissenschaften aufbauen, ihre unterschiedlichen Entwicklungen beeinflussen unser heutiges Wissenschaftsverständnis.
Platon geht davon aus, dass Erkenntnis durch Begriffe erzielt wird, aber nicht durch Wahrnehmung. Aristoteles hingegen geht davon aus, dass Menschen von sich aus nach Wissen („theoretische Neugier“) und damit nach Erfahrung streben. Bereits Aristoteles suchte nach sicheren Begründungen: „Er geht von der Welt unserer Erfahrungen aus, vom gesunden Menschenverstand und nicht von kühnen Thesen“ (Hauk, 2003, S. 80). Mit Aristoteles kann der Beginn der Verwissenschaftlichung der Welt angesetzt werden (vgl. Störig, 1999).
Ausgehend von diesen sehr frühen, aber sehr grundsätzlichen Auseinandersetzungen haben sich zahlreiche Wissenschaftsströmungen entwickelt: Positivismus, Empirismus, Rationalismus, Logischer Empirismus/Logischer Positivismus, Kritischer Rationalismus, Kritische Theorie, Grounded Theory. Auf diese Strömungen soll an dieser Stelle nicht im Detail eingegangen werden, es sollen nur ein paar grundlegende Fakten festgehalten werden: Es gibt nicht das eine Konzept, das Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie darstellt, sondern nur mehrere Zugänge und Ansichten dazu. Das Verständnis von Wissen und wie es erzeugt wird, ist auch immer geprägt von den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund haben sich eben die verschiedenen Strömungen entwickelt, die verschiedene Begründungen für Erkenntnis und Theorie anführen (vgl. dazu bspw. Lauth & Sareiter, 2005; Schülein & Reitze, 2021; Steininger & Hummel, 2015).
Im Kern drehen sich die zentralen – und hart diskutierten – Unterschiede aller wissenschaftstheoretischen Positionen um die Frage, wie und unter welchen Bedingungen Erkenntnis erlangt werden kann . Die Grundfrage ist also, ob Erkenntnis durch Erfahrung, also durch Wahrnehmungen [32] erlangt werden kann (Empirismus) oder ob die Quelle der Erkenntnis der Verstand ist (Rationalismus), die Erkenntnis also auf Sätzen gründet, deren Wahrheit im Lichte der Vernunft „selbstevident“ sind.
In einer sehr (!) reduzierten Beschreibung basiert der Empirismusauf der Annahme, dass jede Erkenntnis und alles Wissen über die Welt nur durch die innere oder äußere Empfindung/Wahrnehmung/Erfahrung möglich ist. Alles Wissen entsteht damit erst durch die Erfahrung. Sinneserfahrung und Beobachtung gelten als Erkenntnisquelle. Im Rationalismusist die „Ratio“, sind das Denken und die Vernunft die einzige oder wichtigste Erkenntnisquelle. Aus diesen Zugängen leiten sich auch die „klassischen Vorgänge“ für die Begründung und Überprüfung von Hypothesen/Theorien ab: die axiomatische Wissenschaft und die empirische Wissenschaft.
Die axiomatische Wissenschaft folgt dem Konzept einer nicht-empirischen (erfahrungsunabhängigen) Begründung der wissenschaftlichen Erkenntnis (v. a. in Mathematik und Naturwissenschaft), die Erkenntnis folgt aus logischen Folgerungen, dies erfordert formale Logik. Der zentrale Begriff der formalen Logik ist dabei die logische Folgerung (Deduktion). In der axiomatischen Theorie gibt es eine Liste von Axiomen, das sind grundlegende Annahmen der Theorie über den jeweiligen Geltungsbereich. Aus diesen Axiomen können alle anderen Aussagen der Theorie als logische Deduktion abgeleitet werden. Diese Aussagen sind Theoreme. Die Gültigkeit der Theoreme ist sichergestellt, vorausgesetzt, die Axiome sind korrekt. Die Verifikation der Axiome erfolgt nicht durch formallogische Vorgänge, sondern durch die Berufung auf unmittelbare Evidenz oder auf Erfahrung und Experiment. Das (große) Problem dabei ist: Axiome sind letztlich Basissätze, die nur per Konsens, damit letztlich dogmatisch begründet werden (aber weder induktiv noch deduktiv). Die empirische Wissenschaft folgt dem Modell einer empirischen Begründung und Überprüfung von wissenschaftlichen Theorien. Die Zuschreibung von Wahrheitswerten zu den Axiomen einer wissenschaftlichen Theorie erfolgt auf empirischer Basis, also auf Grundlage von Beobachtungen, Messungen, Experimenten, die Axiome sollen durch Induktion begründet werden, also durch eine induktive Verallgemeinerung von empirischen Befunden (vgl. Lauth & Sareiter, 2005, S. 18–20).
Beide Strömungen haben zahlreiche Befürworter und Kritiker gefunden, die Diskussion wurde im 20. Jahrhundert noch durch eine große Frage erweitert: Sind naturwissenschaftliche Methodenideale auf die Methoden der Sozialwissenschaften übertragbar? Können absolute, unbeeinflusste Fragen gestellt und derartige Aussagen getroffen werden? Dabei geht es im Kern um den Einfluss von Werten, [33] d. h. von persönlichen Meinungen, politischen Anschauungen etc., auf die wissenschaftliche Arbeit. Daraus entwickelten sich wirkungsmächtige Diskurse: der sog. Positivismusstreitund die Werturteilsproblematik.
Читать дальше