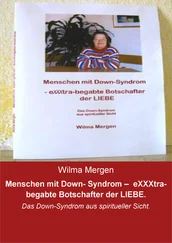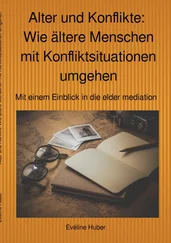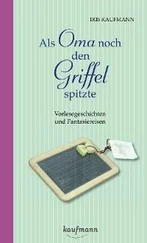freie Ensembles
freie Ensembles 
Neben der beeindruckenden Anzahl öffentlich finanzierter Orchester gibt es in Deutschland hunderte freie Ensembles: Die meisten agieren in variablen Besetzungen und mit bestimmten Schwerpunkten, manche nur als lokale Player, manche international – wie zum Beispiel das Freiburger Barockorchester, das Ensemble Modern Frankfurt, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen oder das Ensemble Resonanz in Hamburg, um einige berühmte Namen herauszugreifen. Und oft sind es diese freien Gruppen, die mit neuen künstlerischen Ideen zur Gestaltung der Konzerte oder zur Gewinnung neuen Publikums Wege in die Zukunft eröffnen und die klassische Musik mit alternativen Konzepten in die Gesellschaft hineintragen (vgl. Lorber & Schick 2019).
Der Arbeitsalltag von Profimusikerinnen und -musikern
Für eine Musikerin oder einen Musiker macht es einen existenziellen Unterschied, ob sie oder er in einem Orchester in öffentlicher Trägerschaft oder einem freien Orchester engagiert ist.
 Arbeitsstrukturen im Orchester
Arbeitsstrukturen im Orchester 
Die Musikerinnen und Musiker der öffentlichen Klangkörper arbeiten in festen Strukturen und Festanstellungen, die durch den »Tarifvertrag für Kulturorchester« bzw. die Rundfunk-Tarifverträge genau geregelt werden. Darin werden die wöchentliche Anzahl und Dauern der sogenannten »Dienste« (Proben und Aufführungen) ebenso festgelegt wie die Eingruppierung in bestimmte Tarifstufen. Diese Personen sind Angestellte im öffentlichen Dienst – mit allen Sicherheiten und Unfreiheiten, die das mit sich bringt. Kulturorchester sind hierarchisch strukturiert, auch wenn die Orchestervorstände Beratungs- und Mitspracherecht haben. Die Programme und der Spielbetrieb werden jedoch von Chefdirigentinnen bzw. Chefdirigenten (oder Generalmusikdirektorin bzw. Generalmusikdirektor) und/oder Intendantin bzw. Intendant entschieden und verantwortet.
 Gestaltung der Dienste
Gestaltung der Dienste 
Musikerinnen und Musiker aus Kulturorchestern werden ein Konzert für Menschen mit Demenz im Rahmen ihres tariflichen Dienstes spielen. Auch Besuche von Musikerinnen und Musikern in Einrichtungen der Altenpflege könnten im Rahmen eines solchen Dienstes unternommen werden – wenn es von Orchesterleitung und Intendanz gewünscht und geplant wird. Da die Kulturorchester die ganze Saison hindurch spielen, sind ihre Mitglieder das Jahr über vor Ort und wohnen daher in der Regel auch am Sitz des Orchesters. Das bedeutet, dass kleinere Musikergruppen (Kammermusik-Ensembles wie Duos, Trios, Quartette, Quintette) ganzjährig zu Verfügung stehen können.
 Arbeitszeiten von Orchestermusikerinnen und -musikern
Arbeitszeiten von Orchestermusikerinnen und -musikern 
Typischerweise absolvieren städtische Orchester, die zumeist an Opernhäuser angebunden sind, ihre Dienste vormittags (etwa zwischen 10 und 13 Uhr für eine Orchesterprobe) und abends (in der Regel ab 20 Uhr für ein Symphoniekonzert und ab 19.30 Uhr für eine Opernvorstellung). Die Nachmittage werden von den Musikerinnen und Musikern individuell für Unterricht, für Proben zu eigenen Projekten (zum Beispiel Kammermusik) oder zum Üben genutzt. Gleiches gilt auch für die Sängerinnen und Sänger der Opernchöre in Deutschland. Und auch wenn diese im Hauptberuf »nur« im großen Kollektiv singen, haben alle Mitglieder eine solistische Gesangsausbildung durchlaufen und können außerhalb ihres Dienstes als Solistinnen und Solisten in Kirchenkonzerten und anderen Veranstaltungen aktiv werden.
 Finanzierung freier Ensembles
Finanzierung freier Ensembles 
Die freien, zum Teil basisdemokratisch arbeitenden Orchester hingegen finanzieren sich über ein Gespinst aus Projektmitteln der öffentlichen Hand (die jährlich neu beantragt und begründet werden müssen), Stiftungs- und Sponsorengeldern, Gastspiel- und Medien-Honoraren sowie Ticketeinnahmen. Die meisten dieser Orchester beschäftigen ihre Musikerinnen und Musiker nur für begrenzte, oft sehr intensive Proben- und Konzertphasen auf der Basis von Werkverträgen: kein Konzert, kein Geld 8 . Diese prekäre Situation betrifft die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten eines weihnachtlichen Oratorienkonzerts in der Dorfkirche ebenso wie die etablierten Konzertreihen oder Gastspielreisen renommierter Kammerorchester.
 Einkommensquellen für Selbstständige
Einkommensquellen für Selbstständige 
Die selbstständigen Musikerinnen und Musiker der freien Orchester müssen daher für verschiedenste Auftraggeber tätig sein: Sie spielen in mehreren freien Ensembles, helfen fallweise in Kulturorchestern aus, spielen Bühnenmusik in der Oper, Theatermusik im Schauspiel oder im Musical, arbeiten als Honorarkräfte an Musikschulen oder Musikhochschulen (auch hier gilt: keine Unterrichtsstunde, kein Geld) und geben privaten Musikunterricht. In vielen Regionen sind auch Kirchenkonzerte eine wichtige Einnahmequelle. Reichtümer sind damit kaum zu erwirtschaften: die Künstlersozialkasse benennt das durchschnittliche Jahreseinkommen freiberuflicher Musikerinnen und Musiker zurzeit mit gut 15.300 Euro 9 .
 Projektarbeit
Projektarbeit 
Aus Gründen der Qualität arbeiten fast alle freien Orchester mit einem festen Stamm von Musikerinnen und Musikern. Diese kommen oft aus ganz unterschiedlichen Regionen zusammen – und sind nach der Projektphase in einem Konzert- oder Tourneeprojekt anderswo beschäftigt. Das bedeutet, dass Konzerte für Menschen mit Demenz oder Besuche in sozialen Einrichtungen nur während oder im Anschluss der jeweiligen Projektphasen stattfinden können. Ansonsten müssen sie gesondert vereinbart und eigens finanziert werden.
Planungsansätze von Konzerten für Menschen mit Demenz
 Demenzkonzerte als Projekt
Demenzkonzerte als Projekt 
Ein speziell konzipiertes Konzert für Menschen mit Demenz ist allerdings für beide Orchesterformen – ob frei oder öffentlich – immer ein zusätzliches Projekt, für das ein eigener Termin gefunden und ein Budget reserviert werden muss. Deshalb bietet es sich an, Synergie-Effekte zu nutzen.
Читать дальше
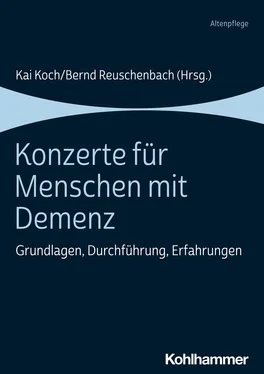
 freie Ensembles
freie Ensembles