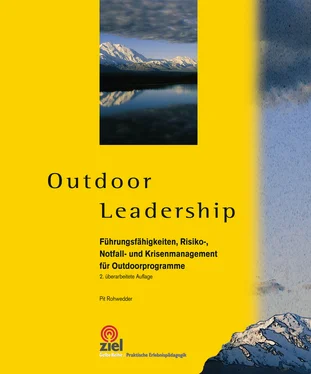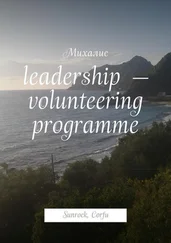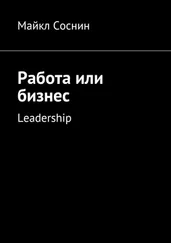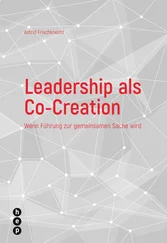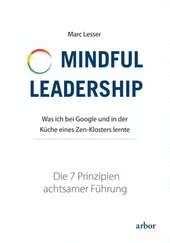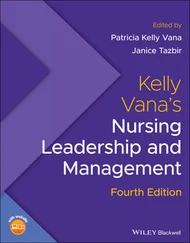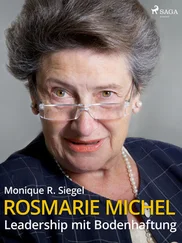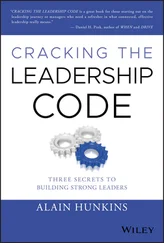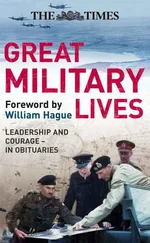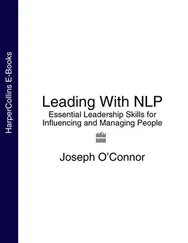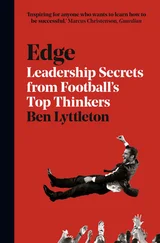Vorwort
Ach entzögen wir uns Zählern und Stundenschlägern.
Einen Morgen hinaus, heißes Jungsein mit Jägern,
Rufen im Hundegekläff.
Daß im durchdrängten Gebüsch Kühle uns fröhlich besprühe,
und wir im Neuen und Frein – in den Lüften der Frühe
fühlten den graden Betreff!
Solches war uns bestimmt. Leichte beschwingte Erscheinung.
Nicht, im starren Gelaß, nach einer Nacht voll Verneinung,
ein verneinender Tag.
Diese sind ewig im Recht: dringend dem Leben Genahte;
weil sie Lebendige sind, tritt das unendlich bejahte
Tier in den tödlichen Schlag.
Draußen sein, das heißt Lebendig-Sein, das bedeutet Energie, Beschwingtheit, Sinn- und Kohärenzerleben, „graden Betreff“, wie R.M. Rilke dies in seinem Gedicht „Vollmacht“ formuliert.
Die „Outdoors“ rufen uns mit ihren besonnten Berghängen, ihren firnspiegelnden Graten, der Weite der Ozeane, dem Schweigen der Wälder; und wir hoffen und fürchten gleichzeitig, aus den Outdoors als veränderter Mensch zurückzukehren.
Outdoorunternehmungen werden in den unterschiedlichsten Kontexten angeboten und eingesetzt, Pit Rohwedder gliedert sie gleich zu Beginn. Die „Erlebnispädagogik“ – um ein Segment herauszugreifen – ist mittlerweile einer fachlich fundierten und anerkannten pädagogischen Herangehensweise gereift. Noch immer verspricht sie – zu Recht – den Alltag, den „verneinenden Tag“ zu verlassen, um in der Kühle des neuen Morgens neu zu beginnen.
Doch die Outdoors bergen auch den „tödlichen Schlag“. Wir wollen in ihn nicht treten, und wenn wir andere hinaus begleiten, dann müssen wir ihn vermeiden. Dies zu leisten, hat die Erlebnispädagogik einen robusten Bestand an Sicherheitswissen entwickelt.
In den vergangenen Jahren wird die Diskussion um Sicherheit bei Outdoorunternehmungen durch die Begriffe „Sicherheits-„und „Risikomanagement“ erweitert, die eine zusätzliche systematische Sichtweise einfordern. Und mit der Einsicht, dass ein Notfall auch eine Krise ist, wurde zusätzlich die Wichtigkeit deutlich, sich präventiv nicht nur mit ihm, sondern auch mit der Bewältigung der damit gegebenen Krise zu beschäftigen („Krisen- und Notfallmanagement“).
Diese Begriffe markieren einen neuen Entwicklungsschritt der Gemeinschaft der in den Outdoors Tätigen. Der Verdacht, dass nun die Zähler und Stundenzähler ihre Zelte auch draussen aufschlagen, ist nicht ganz von der Hand zu weisen – aber es handelt sich um einen notwendigen Prozess, denn jeder Unfall ist zu viel.
Pit Rohwedder gebührt das Verdienst, die Bedeutung und Tragweite dieser erweiterten Sichtweise früh erkannt zu haben. Als Praktiker, der vor allem in alpinen Handlungsfeldern jahrzehntelange Erfahrung vorweisen kann, ist er unverdächtig, ein „Zähler“ zu sein. Vielmehr weiß er, durchaus auch aus leidvoller Erfahrung, wovon er schreibt. In der Arbeit mit Notfallszenarien konnte er die Konzepte erarbeiten und prüfen, die er im vorliegenden Buch zusammenfasst.
Er ist nicht nur der Erste, der dies in Buchform gießt, es ist auch sein „Erstes“. Geschrieben mit Praxiswissen und Herzblut. Daher wünsche ich dem Buch die Resonanz, die das Thema verdient.
| Martin Schwiersch |
Pfronten, im Mai 2008 |
Einführung
Mein persönlicher Zugang zum Thema Outdoor Leadership ist geprägt durch eine jahrzehntelange Arbeit mit wechselnden Zielgruppen in unterschiedlichsten Naturlandschaften. Ob in den Führungsaufgaben als Bergführer, in der erlebnispädagogischen Begleitung von Jugendlichen zur Persönlichkeitsentwicklung oder in der Lernprozessgestaltung bei Führungskräften und Teams aus der Wirtschaft im Rahmen von Outdoortrainings, immer wurde ich mit differenzierten Aufgaben, Ansprüchen, Rollen und damit verschiedenen Leadership Aspekten konfrontiert.
Da wir letztlich immer in einem Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen und Ziele sind, nämlich derjenigen der Teilnehmer, der Veranstalter und uns selber, wurde mir dadurch die Wichtigkeit einer eindeutigen Auftrags- und Rollenklärung bewusst.
Durch zahlreiche Unfallbeispiele von Experten gewann ich allmählich den Eindruck, dass menschliche Faktoren in ihren Auswirkungen auf Sicherheitsfragen und Risikomanagementstrategien nicht genügend einbezogen werden.
Als Lehrtrainer diverser Zusatzausbildungen forderten mich diese Themen natürlich auf einer konzeptionellen und methodischen Ebene heraus, denn in der Regel wird in Outdoorausbildungen ein eher einseitiger Wert auf Führungstechniken zur Reduzierung des Unfallrisikos gelegt, nicht aber die eigene Rollenklärung und das „Wie“ des Führungsverhaltens mit Gruppen ausgebildet.
So ist letztlich die Motivation für dieses Buch entstanden.
Outdoor Leadership ist ein Begriff, der bei uns im deutschsprachigen Raum bisher wenig Verbreitung fand. Der Begriff Outdoor wird heutzutage nicht mehr nur für die Natur und Wildnislandschaften verwendet, sondern häufig einfach für das Draußen sein benutzt, auch wenn es im Park oder auf der nahe gelegenen Wiese stattfindet, wie das in Outdoortrainings häufig der Fall ist. Leadership ist ein breiter Begriff für Führung schlechthin.
Der Begriff Outdoor Leadership findet in den handlungsorientierten Programmen der amerikanischen National Outdoor Leadership School wohl eine seiner populärsten Verbreitungen. Die Idee des Gründers Paul Petzoldt war einfach: „Take people into the wilderness for an extended period of time, teach them the right things, feed them well and when they walk out of the mountains, they will be skilled leaders“. ( www.nols.com)
In bis zu 30 tägigen Kursen unter expeditionsartigen Bedingungen lernen die Teilnehmer verschiedene Fähigkeiten wie Führung, Motivation, Kooperation, Kommunikation, Konfliktbewältigung, Organisations- und Managementfähigkeiten, Selbstwahrnehmung und Entscheidungsverhalten unter Stress.
Durch die Publikation „Handbuch für Outdoor Guides“ von Hans Peter Hufenus (Hufenus, 2003) wurde der Begriff des Outdoor Guides im deutschsprachigen Raum bekannter. Hufenus definiert darin die klassischen Tätigkeiten eines Outdoor Guides für die Bereiche Trekking, Wildnisreisen, Freizeit- und Lagergestaltung, Kanuwandern, Seekajakreisen und Schneeschuhlaufen und beschreibt die dazu notwendigen „Outdoor Guide Kompetenzen“ (Hufenus, S. 21
), wie etwa Orientierung, Gefahrenkunde, Survivalaspekte, Feuer machen und organisatorische Fähigkeiten.
Bewusst verzichtet er auf eine detaillierte Darstellung der wichtigen weichen Faktoren (soft skills), nämlich Führungsfähigkeiten, psychologische Kenntnisse und gruppendynamisches Wissen, ohne deren Bedeutung damit zu schmälern.
Outdoor Leadership möchte ich hier als eine komplexe Fähigkeit vor allem hinsichtlich der weichen Faktoren beschreiben und das Buch richtet sich an alle Personen, die Outdoorprogramme durchführen, unabhängig davon, ob sie in ursprünglichen Natur- und Wildnislandschaften unterwegs sind oder in Parks und künstlichen Erlebniswelten, wie die der Seilgärten. Da ich die weichen Faktoren auch immer in Bezug zu Sicherheitsfragen und Risikomanagementstrategien betrachte, eignet sich das Buch auch für Veranstalter, die ihre Sicherheitskonzepte um diese Faktoren erweitern wollen.
Die ersten beiden Kapitel setzen sich mit Leitungs- und Führungsstilen auseinander und möchten sowohl zur Reflexion des eigenen Leadership Handelns einladen, als auch geeignete Steuerungsinstrumente für die Arbeit mit Gruppen vorstellen.
Anschließend wird im dritten Kapitel der Versuch unternommen, verschiedene Risikomanagementstrategien vorzustellen und die menschlichen Einflussfaktoren dabei stärker zu integrieren.
Da jedoch auch bei größter Vorsicht ein Unfall nicht immer ausgeschlossen werden kann, beschreibe ich im vierten und fünften Kapitel wichtige Kompetenzen, wie Notfälle und sich daraus entwickelnde Krisensituationen bewältigt werden können.
Читать дальше