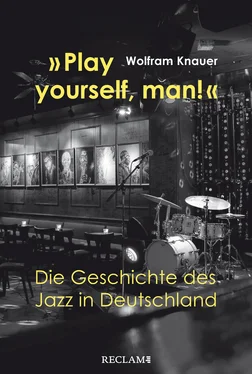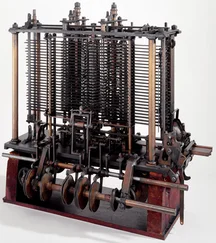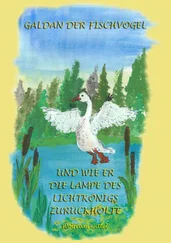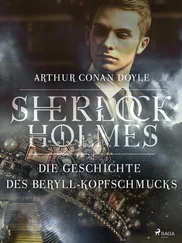Dajos Béla hatte etliche ausländische Solisten in seinen Reihen und brachte ab 1926 einige Aufnahmen heraus, auf denen der britische Trompeter Howard McFarlane, die Amerikaner Walter Kallander (Altsaxophon), Mike Danzi (Banjo), Dick Stauff (Schlagzeug) und der aus England stammende gebürtige Südafrikaner Edgar Adeler (Piano) zu hören waren. Unter den Namen The Odeon Five, Clive Williams Original Jazzband, später auch und mit geänderter Besetzung als Mac’s Jazz Orchestra oder als Mac’s Merry Macs eiferten sie Red Nichols and his Five Pennies nach, die in den USA einen antreibenden, dabei aber sauberer als viele der afro-amerikanischen Ensembles intonierenden Stil entwickelt hatten.51 Danzi beschreibt den grundlegenden Unterschied des musikalischen Ansatzes: »Wir hörten amerikanische Bands in Berlin und wir hatten die neuesten amerikanischen Platten von Phil Napoleon, Miff Mole und Red Nichols, und wir mussten das alles nicht ausschreiben wie die deutschen Musiker.«52 Die Merry Macs waren gut vernetzt, und neben Béla nutzten auch andere der großen Orchester ihre virtuosen improvisatorischen Fähigkeiten gerne für ihre Aufnahmen, so dass die Musiker schon mal am selben Tag mit Dajos Béla für Lindström und mit Marek Weber für Electrola ins Studio gingen. »Ace in the Hole«, eingespielt von Mac’s Jazz Orchestra im Januar 1927, zeigt den amerikanischen Einfluss: ein spielerisches Arrangement, in dem die Rhythmusgruppe den Beat über fast drei Minuten bei Spannung hält und die aus der Band auf- und wieder abtauchenden Soli der Ensemblearbeit in nichts nachstehen.
Bernard Ettéwurde 1898 in Kassel geboren und begleitete bereits mit zwölf Jahren als Geiger Stummfilme. 1915 gründete er seine erste eigene Band, trat nach dem Krieg in Bad Nauheim und Garmisch-Partenkirchen auf und kam 1923 nach Berlin, wo er auch seine ersten Einspielungen machte. Er war bald einer der meist aufgenommenen Musiker der deutschen Szene, Deutschlands populärster Bandleader, wie Banjospieler Mike Danzi bezeugt. Egal wo sie gerade auf Tour waren, alle zwei Wochen fuhr Etté nach Berlin, um neue Titel für das Plattenlabel Vox aufzunehmen. Danzi schildert das Tourneeleben jener Jahre, in denen Etté, dessen Orchester zur offiziellen Turnierkapelle des Reichsverbands für Tanzsport ernannt worden war, fast alle Tanzturniere in den großen Städten Deutschlands spielte:53 »Es war ein stressvolles Leben, den ganzen Tag lang reisen, dann Nachmittags-Tea-Dances und am Abend Konzerte, von acht Uhr bis nach Mitternacht, oft bis halb zwei morgens.«54
Etté war 1924 zum ersten Mal in den USA gewesen, und ihn faszinierte an Paul Whitemans Konzept eines symphonischen Jazz, »dass man Jazz nur um der Musik willen spielen kann, dass diese Musik nicht ausschließlich als Tanz-Begleitung, sondern auch als selbständiges Kunstwerk dargeboten werden kann und was nicht minder wichtig ist: Jazz und Klamauk nicht identisch sind.«55
Bei seinem nächsten New York-Besuch im Jahr 1927 resümiert Etté, dass sich viel geändert, dass der amerikanische Jazz »einen unerhörten Grad von Kultur erreicht« habe. Bei alledem aber stehe der Tanz meist nach wie vor im Mittelpunkt, wie er feststellt und den Jazz damit gleich wieder ins Repertoire einordnet, das man nun mal als Unterhaltungskünstler beherrschen müsse: »Und dann muss ich Ihnen noch ein Geständnis machen: Beliebt bleibt der gute alte Walzer.«56
»Wenn die Jazzband spielt« stammt vom März 1925 und beginnt mit einer simulierten Radioansage; es folgt ein deutlich bemühtes Arrangement mit betont herausgehobenen Synkopen, die erahnen lassen, worauf Ernst Krenek zwei Jahre später in seiner Oper Jonny spielt auf oder Kurt Weill in einigen seiner mit Bertolt Brecht verfassten Bühnenstücke anspielten. Improvisation spielt hier genauso wenig eine Rolle wie eine deutliche Orientierung an amerikanischen Vorbildern. Anders sieht es bereits bei »Copenhagen« aus, das Etté im September 1925 aufnahm, und dem man anmerkt, dass die Musiker aufmerksam Schallplatten gelauscht haben mussten – etwa jener, die Bix Beiderbecke mit seinem Wolverine Orchestra 1924 von dem Stück gemacht hatte. Bernard Ettés Orchester blieb die ganzen 1930er Jahre als Schauorchester populär und bestand bis kurz vor Kriegsende. 1950 nahm er noch ein paar Schlager und Stimmungslieder auf, trat vereinzelt bei Bällen auf und starb 1973 verarmt in einem Altersheim in Bayern.
Schließlich ist auch Efim Schachmeisterzu nennen, der 1894 – genau weiß man es nicht – in Rumänien oder in Kiew geboren wurde, von 1910 bis 1913 in Berlin klassische Geige studierte und ab 1915 regelmäßig bei Bällen und in den Berliner Hotels spielte. Während Dajos Béla bei Lindström aufnahm, war Efim Schachmeister quasi die Antwort der Deutschen Grammophon. Sein Orchester trug auf Platten oft die Bezeichnung »Jazz-Symphonie-Orchester« und nahm sich neben den Schlagern, Kabarettliedern und Tanznummern, die alle spielten, auch einiger authentischer Jazztitel an. Von 1927 etwa stammt der »St. Louis Blues«, in dem Schachmeisters Geigenpassage noch die unjazzigste ist, wogegen Soloklarinettist, -trompeter und -posaunist nicht nur versuchen, die Spontaneität der Jazzimprovisation rüberzubringen, sondern darüber hinaus auch mit der Klangvarietät zu spielen, die amerikanische Kollegen durch Ansatztechniken und den Einsatz diverser Dämpfer hinbekamen.
Noch eindrucksvoller ist »Stampede« von 1926, in dem Schachmeisters Band das Fletcher-Henderson-Arrangement (um Streicher ergänzt) nachzuspielen versucht und in dem man besonders deutlich hören kann, was durchaus ganz gut klappt und was überhaupt nicht. Einen durchgehenden Beat kriegen sie hin, aber die von Hendersons Band so sicher gesetzten Akzente werden hier zu unrunden überzogenen Synkopen – und das penetrante Stakkato der Trompeten hilft nicht, diesen Mangel wettzumachen. Immerhin: Henderson hatte das Stück nur wenige Monate zuvor eingespielt, und Schachmeister verstand es, das Arrangement auf seine Besetzung umzuschreiben (aus dem Klarinettentrio wurde dabei ein Geigenduo), und auch die anderen Musiker hatten sich die Intensität der Solopassagen Hendersons gut angehört. 1933 ging Schachmeister, der Jude war, in die Niederlande und emigrierte schließlich 1938 nach Argentinien.
Der Geiger Marek Weberwurde 1888 in Galizien geboren und hatte sich, nachdem er von zu Hause fortgelaufen war, als Stehgeiger seinen Lebensunterhalt verdient. Mit 14 spielte er in der Oper in Lemberg, mit 18 ging er nach Berlin, um sein Studium dort fortzusetzen. Ab 1910 wird über den Violinvirtuosen berichtet, der mal mit Streichquartett, mal mit siebenköpfigem Salonorchester auftrat. Viele der Tanzorchester der 1920er Jahre bestanden aus Musikern, die ihre Instrumente durchaus gut beherrschten, allerdings, wie bereits gezeigt, eher ungeübt in der Kunst der Improvisation waren. Erst im Verlauf, etwa ab den 1930er Jahren, änderte sich das Niveau auch der solistischen Parts in den Aufnahmen. Nun engagierten Bands, die eigentlich vor allem in Hotels zum Tanz aufspielten, für die jazzigeren Parts spezielle Musiker, die für ihre Improvisationsfähigkeit bekannt waren, sogenannte Hot-Solisten.57 Nichts anderes tat Marek Weber, dessen Ensemble bald in den führenden Hotels der Stadt auftrat, so etwa seit 1926 im Adlon, wofür er zusätzliche englische und amerikanische Solisten engagierte. Weber selbst habe den Enthusiasmus für die Jazzsoli nicht so recht verstanden, erzählt Banjospieler Mike Danzi, der mit ihm im Adlon auftrat, aber die Frau des Hotelbesitzers war begeistert und sorgte dafür, dass die Vertragsverlängerung mit dem Bandleader daran geknüpft wurde, dass auch die Hot-Solisten weiter mitwirkten.58 1927 entstand Webers Aufnahme von »Crazy Words« (HMV E.G. 641) mit einem Solo des afro-amerikanischen Trompeters Arthur Briggs, der zeitweise bei Weber mitwirkte, gefolgt von einem schmalzigen Geigensolo des Bandleaders. Der Titel wird auf dem Label der Platte als »Einlage in der Haller-Revue 1927/28 ›Wann und Wo‹« beschrieben und wurde auch von anderen Bands, etwa der des Pianisten Hermann Bick alias Ben Berlin, eingespielt. In einer zweiten Aufnahme durch Marek Weber (HMV E.G. 639) wird Briggs im selben Arrangement von einem anderen Trompeter ersetzt, und der Unterschied ist enorm: Wo Briggs in seinem Solo mit sicherer Stimme die Töne beugte, ist dieser Trompeter vor allem darum bemüht, seine Phrasen rhythmisch spannend zu betonen; Soundnuancen bleiben da ziemlich außen vor. Marek Weber ging 1933 nach England, lebte dann eine Weile in der Schweiz und emigrierte 1937 in die USA, wo er sich schließlich als Geflügelfarmer in der Nähe von Chicago niederließ.
Читать дальше