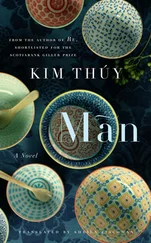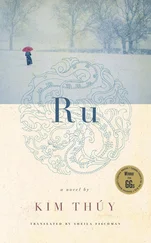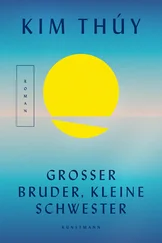Mein Vater hatte sich das Haus in der Hai-Bà-Trưng-Straße in Saigon angeeignet, wo er seine Geliebten und seine Freunde empfing. Sie trafen sich dort zum Pingpong oder Pokern mit ihrer jeweiligen Favoritin oder auch für »verbotene Spiele«, wie er in Anlehnung an einen berühmten französischen Film gern sagte, dessen Titelmelodie jeder junge Vietnamese lernte, der sich am Gitarrenspiel versuchte. Auch nach seiner Hochzeit nutzte er diesen Ort weiter zu denselben Zwecken, wie es viele Männer seiner Kreise machten. Aus Taktgefühl und um zu überleben überschritt meine Mutter nie die Schwelle dieses Hauses. Sie erinnerte nur den getreuen Diener meines Vaters daran, stets einen Teller mit frischem Obst bereitzustellen, getrocknete Krabben mit mariniertem wildem Knoblauch zum Reisschnaps und Baguette und Pasteten zum Wein.
Dieser Diener war und ist der engste Freund meines Vaters. Sie sind nur drei Monate auseinander. Meine Großmutter väterlicherseits hatte seine Mutter als Amme für meinen Vater eingestellt, ohne zu wissen, dass die junge Frau ihr Dorf verlassen hatte, um ihr Kind auszutragen. Die beiden Jungen wurden Brüder, die gemeinsam mit Murmeln spielten, Heuschreckenkämpfe und Schwertgefechte austrugen. Außerdem zogen sie Kampffische auf, jeden in einem Glas, mit Kartons dazwischen, um sie bis zum Kampf zu schonen. Manchmal erlaubten sie einander, die Kartons wegzunehmen, und bewunderten das Entfalten der Flossen. Der Blaue schlug mit seinem Schwanz einen Halbmond; der Weiße fegte mit seinen Volants durchs Wasser, als wäre sein langes Brautgewand leicht wie Luft; der Orange war weniger spektakulär, aber äußerst wertvoll, weil er nie aufgab; so angriffslustig der Orange war, so perfekt beherrschte der Gelbe die Kunst auszuweichen und geduldig den fatalen Moment abzuwarten, in dem er sich auf den Gegner stürzte. Die beiden Jungen brachten viele Stunden damit zu, über die Persönlichkeit ihrer Fische zu diskutieren und sie mit Fliegenlarven zu füttern. Ihre Leidenschaft für diese Fische aus dem stehenden Wasser der Reisfelder hielt sich bis ins Erwachsenenalter. Ihre Sammlung wuchs, als sie auch Weibchen aufziehen konnten und wussten, wie man sie in den Paarungsperioden den Männchen zuführte. Sie beobachteten genau, wie die Männchen zur Geburtsvorbereitung Blasennester bauten und die Weibchen verjagten, sobald sie darin abgelaicht hatten. Dann setzten sie die Weibchen in ein anderes Glas, damit sie den Nachwuchs nicht auffraßen. Die Jungen zogen ihre Fische gemeinsam groß, wie eine Familie, die nur ihnen gehörte. Sie hatten ihre Lieblinge, doch der Verlust jedes Einzelnen betrübte sie zutiefst.
MEIN VATER UND SEIN DIENER waren Brüder mit unterschiedlichen Familiennamen, unterschiedlichen Eltern und unterschiedlichen Schulen. Der eine ging in die Schule des Viertels mit einem Boden aus gestampfter Erde, der andere trug seine Bücher in einer Tasche aus Elefantenleder. Alle kannten die Schule meines Vaters, die nach Pétrus Ký benannt war, einem Intellektuellen, der die vietnamesische Schriftsprache nach dem römischen Alphabet statt in chinesischen Zeichen gelehrt und verbreitet hatte. Obwohl das Vietnamesische heute in Lautschrift notiert wird, tragen die meisten Wörter noch Spuren der ursprünglichen Ideogramme.
Mein Vorname, Bảo Vi, kündet von der Absicht meiner Eltern, »die Kleinste zu beschützen«. Wörtlich übersetzt, heiße ich »winzige Kostbarkeit«. Wie den meisten Vietnamesen gelang es mir nie, meinem Namen gerecht zu werden. Mädchen, die »Weiß« (Bach) oder »Schnee« (Tuyết) heißen, haben oft sehr dunkle Haut, Jungen mit dem Namen »Macht« (Hùng) oder »Stark« (Mạnh) fürchten sich vor großen Prüfungen. Ich wiederum wuchs unaufhörlich, bis ich den Durchschnitt bei Weitem überholt hatte, und übertrat mit dem gleichen Elan sämtliche Regeln. Die Lehrer setzten mich in die letzte Bank, um die Klasse besser überblicken zu können. Wenn sie die kleinste falsche Bewegung entdeckten, zitierten sie den Schuldigen augenblicklich zur Tafel, wo er sich unter den Blicken seiner sechzig Mitschüler mit offenen Händen hinstellen musste und mit dem Holzlineal auf die Handflächen oder die Gelenke geschlagen wurde. Danach fiel es ihm unglaublich schwer, die Feder zu halten, die Spitze ins Tintenfass zu tunken und ohne Zittern zu schreiben. Sosehr er sich auch bemühte und mit rosa Löschpapier in der linken Hand die Bewegung der Feder begleitete, um überschüssige Tinte aufzusaugen, gelang es ihm kaum, den Zwei-Millimeter-Linien der Séyès-Hefte zu folgen, ohne darüber hinauszufahren und Flecken auf die Blätter zu machen. So bekam er zu seinen geschwollenen Händen auch noch Punktabzüge wegen seiner Schmiererei. Gemessen an den Leichtsinnigen, die nach hinten versetzt wurden, war ich bestimmt eine Musterschülerin. Oder zumindest zarter, da ich mich nach Kräften bemühte, eine »Vi« zu sein, mikroskopisch klein. Unsichtbar.
Wäre mein Vater am Ende des Krieges ebenso unsichtbar gewesen wie ich, dann wäre er nicht verhaftet und in ein Umerziehungslager in der Gegend von Thủ Đức gesteckt worden, wo er seine tägliche Ration von zehn Erdnüssen mit seinen sechs Hüttenkameraden teilte. Da mein Vater für ein fürstliches Schicksal geboren war, wurde er nach zwei Monaten entlassen. Sein Dienerbruder hatte der Obrigkeit gegenüber erklärt, mein Vater habe seine Spionagetätigkeit für den kommunistischen Widerstand finanziell unterstützt und damit indirekt dem Norden geholfen, den Krieg gegen den Süden zu gewinnen. Indem er ihn so von dem Verdikt befreite, ein kapitalistischer Bürger zu sein, gelang es ihm, meinen Vater zu retten. Ohne das Eingreifen seines Feindbruders hätte mein Vater weiter Kanäle gegraben, Felder entmint und Land gerodet, zusammen mit den anderen Gefangenen, die nicht mehr darauf hofften, den Tag ihrer Befreiung zu erleben. Das Einzige, was sie noch zu hoffen wagten, war, dass eine Heuschrecke oder eine Ratte zum Abendessen vorbeilief, jede andere Überlegung konnte als Verrat am kommunistischen Denken ausgelegt werden. So wurde der Chirurg aus der Nachbarhütte, der ein paar winzige Reisfladen in der Sonne getrocknet hatte, beschuldigt, seine Flucht vorbereitet zu haben, statt sich auf seine Umerziehung zu konzentrieren. Dasselbe passierte einem Buchhalter, als er anderen Gefangenen erzählte, er habe Motorräder an der Nordseite des Gefängnisses vorbeifahren hören. Wenn mein Vater mitbekommen hätte, wie andere Männer auf die Wache zitiert wurden und nicht mehr ins Lager zurückkehrten, hätte er vielleicht beschlossen, aus Vietnam zu fliehen. Und hätte uns nicht alleingelassen auf unserem Weg ins Unbekannte. Dann wäre es ihm vielleicht, wie meiner Mutter, am wichtigsten gewesen, seine Söhne vor dem Militärdienst zu bewahren. So aber zog er sich lieber wieder in den Kokon seines Junggesellenheims zurück, weit weg von den Gezeiten des Lebens.
WIR VERLIESSEN VIETNAM gemeinsam mit Hà, einer engen Freundin meiner Mutter, und deren Eltern.
Hà war sehr viel jünger als meine Mutter. Mit ihren Minikleidern, die ein herzförmiges Muttermal an ihrem linken Oberschenkel entblößten, verkörperte sie Anfang der Siebzigerjahre die moderne, am amerikanischen Lebensstil orientierte Frau in Saigon. Ich erinnere mich an ihre unwiderstehlichen Plateauschuhe im Hauseingang, die mir, wenn ich hineinschlüpfte, ein Gefühl von Dekadenz gaben oder zumindest eine neue Perspektive auf die Welt. Hàs mascaraverkleisterte falsche Wimpern verwandelten ihre Augen in zwei Litschibäume mit buschigem Fell. Sie war unsere Twiggy mit ihrem apfelgrünen oder türkisfarbenen Lidschatten, der sich mit ihrer kupferfarbenen Haut biss. Anders als die meisten jungen Frauen schützte sie sich nicht vor der Sonne, um sich von den Reisbäuerinnen zu unterscheiden, die mit ihren bis über die Knie aufgekrempelten Hosen dem gleißenden Licht ausgesetzt waren, sondern bräunte am Pool des exklusiven Sportklubs, wo sie mir Schwimmen beibrachte. Die amerikanische Freiheit bedeutete ihr mehr als die Eleganz der französischen Kultur und gab ihr auch den Mut, sich am ersten Miss-Vietnam-Wettbewerb zu beteiligen, obwohl sie Englischlehrerin war.
Читать дальше