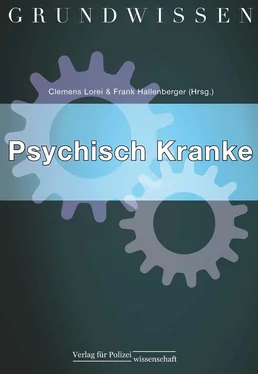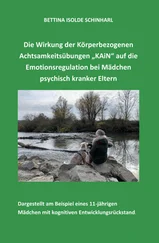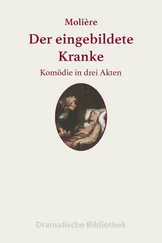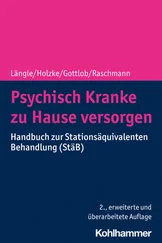Grundwissen Psychisch Kranke
Здесь есть возможность читать онлайн «Grundwissen Psychisch Kranke» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Grundwissen Psychisch Kranke
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Grundwissen Psychisch Kranke: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Grundwissen Psychisch Kranke»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Grundwissen Psychisch Kranke — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Grundwissen Psychisch Kranke», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Panikstörung kann alleine auftreten, häufig aber auch in Verbindung mit einer Agoraphobie.
Generalisierte Angststörung (ICD-10: F 41.1)
Die generalisierte Angststörung zeigt sich darin, dass über viele oder fast alle Lebensbereiche eine anhaltende Angst vorliegt, die nicht auf bestimmte Stimuli beschränkt ist. Es zeigen sich sehr unterschiedliche Symptome wie Nervosität, ständiges Zittern, Muskelanspannungen, ständiges Schwitzen, Schwindelgefühle, Magen-/Darmbeschwerden. Gemeinsames grundlegendes Merkmal der generalisierten Angststörung ist eine ausgeprägte Tendenz, sich um alles und jeden Sorgen zu machen oder ständige Vorahnungen zu haben bezüglich bevorstehender schlimmer Ereignisse. Ein konkretes Beispiel wäre ein Mensch, der im Wohnzimmer sitzt und draußen das Martinshorn eines Einsatzwagens der Polizei, Feuerwehr oder des Notarztes hört und sofort in eine ausgeprägte Angst und Sorge ausbricht, dass einem seiner Angehörigen jetzt etwas passiert ist. Die generalisierte Angststörung weist viele Ähnlichkeiten mit verschiedenen Formen der depressiven Erkrankungen auf. Was sie von der Depression unterscheidet ist die Tatsache, dass Patienten mit generalisierter Angststörung häufig keinen Verlust bestehender Lebensfunktionen wie Antrieb, Appetit oder Schlaf aufweisen.
Sonderformen angstverwandter Erkrankungen
Zwangsstörung (Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen) (ICD-10: F 42)
Die Zwangsstörungen gehören nicht zu den Angststörungen im engeren Sinne; vielmehr zeichnen sich Zwangsstörungen dadurch aus, dass daran erkrankte Patienten häufig immer wiederkehrende Zwangsgedanken mit gewalttätigen oder obszönen Inhalten haben oder ritualisierte Zwangshandlungen (übermäßiges Kontrollieren von Türklinken oder Elektrogeräten, übermäßiges Duschen und Händewaschen) ausführen. Hinter diesen Zwangshandlungen und Zwangsgedanken stehen aber in der Regel Sorgen, Ängste und Befürchtungen, dass bei Unterbleiben gefährliche, unangenehme oder peinliche Ereignisse auftreten könnten. So hat der Patient mit Waschzwängen häufig eine große Angst davor, dass bei Unterbleiben verschiedener Wasch- und Reinigungsrituale eine Ansteckung mit gefährlichen und lebensbedrohlichen Erkrankungen eintritt; der Kontrollzwangspatient hat Ängste vor dem Eintreten von Unfällen, Diebstählen oder ähnlichem.
Im Gegensatz zu den situationsbezogenen Ängsten, die oft auf eine aktuelle oder kurz bevorstehende konkrete Situation gerichtet sind, sind Zwangshandlungen und Zwangsgedanken häufig auf manchmal weit in der Zukunft liegende Ereignisse mit statistisch gesehen niedriger Auftretenswahrscheinlichkeit gerichtet. Falls ein entsprechender Patient sein Zwangsritual nicht ausüben kann, kommt es aber trotzdem zu ausgeprägten körperlichen Reaktionen, wie es auch bei oben beschriebenen Ängsten der Fall ist.
Posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10: F 43.1)
Ebenfalls einen Sonderfall nimmt die „Posttraumatische Belastungsstörung“ (häufig findet man auch die Abkürzungen PTBS oder nach der englischen Bezeichnung Posttraumatic Stress Disorder: PTSD) ein, die nach der ICD-10 nicht zur Gruppe der Angststörungen gehört, sondern zu den sogenannten „Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“. Neben der ICD-10 gibt es noch ein weiteres, insbesondere für psychiatrische Erkrankungen wichtiges Diagnosemanual, das „Diagnostische und statistische Manual psychischer Störungen“ (DSM-IV) 2. In diesem wird die posttraumatische Belastungsstörung zu den Angststörungen gezählt. Von der Symptomatik der posttraumatischen Belastungsstörung zeigt sich in der Tat eine gewisse Ähnlichkeit zu den verschiedenen Angststörungen. So leiden Patienten mit PTBS auch unter einem erhöhten psychophysiologischen Erregungsniveau, sind häufig angespannt und zeigen ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten vor schwierigen Situationen. Zusätzlich finden sich Alpträume und hartnäckige, nicht zu stoppende Erinnerungsattacken an das auslösende Ereignis. Wichtigster Unterschied der PTBS zu den Angststörungen ist jedoch, dass für die posttraumatische Belastungsstörung als diagnostisches Kriterium zwingend gefordert ist, dass ein traumatisierendes Ereignis von außergewöhnlichem Schweregrad (tatsächliche Bedrohung von Leben oder Gesundheit) vorhanden ist. Nur wenn ein solches auslösendes und traumatisierendes Ereignis mit dem entsprechenden Schweregrad vorliegt, kann von einer posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen werden; bei Angststörungen kann, muss es aber in der weitaus größten Zahl der Fälle nicht zu einem auslösenden Ereignis gekommen sein. Auch die posttraumatische Belastungsstörung lässt sich verhaltenstherapeutisch gut behandeln. 3
Epidemiologie und Komorbidität
Häufigkeit von Angsterkrankungen
Generell gehören Angststörungen zu den häufigsten seelischen Erkrankungen; je nach Studie wird für sämtliche Formen der Angsterkrankungen von einer sogenannten Lebenszeitprävalenz (d. h. wie viele Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens zumindest einmal an einer Angsterkrankung) zwischen knapp 14 und knapp 25 % ausgegangen 4(Bandelow 2001); dies bedeutet, dass jeder Vierte bis Siebte einmal in seinem Leben an einer Angststörung leiden wird.
„Die Agoraphobie weist eine Lebenszeitprävalenz nach Schneider und Markgraf (1998)5 von knapp 6 %, die Panikstörung von 2,4 % auf.
Die spezifischen Phobien kommen nach Perkonigg & Wittchen (1995) 6auf Häufigkeiten zwischen 4,5 und 11 %, die soziale Phobie zwischen 11 und 16 %.
Komorbidität
Nach Wittchen (1991) 7leiden Angstpatienten häufig meist zusätzlich unter Depressionen und vor allen Dingen unter Medikamenten- und Alkoholabusus. Alkoholmissbrauch ist eine der häufigsten Komorbiditäten und oft Folge eines sogenannten inadäquaten Selbstheilungsversuchs. Zu diesem kommt es, wenn Menschen mit Ängsten die damit verbundene körperliche Anspannung, aus diesen möglicherweise resultierende Schlafstörungen oder für sie schwierige z. B. soziale Situationen mit Alkohol besser aushalten können. Aus einzelnen so bewältigten Situationen kann die Erfahrung entstehen „Mit Alkohol komme ich besser klar!“. Dies kann dann vom chronischen Missbrauch bis hin zur Alkoholabhängigkeit führen. Das Gesagte gilt gleichermaßen für die regelmäßige Einnahme von Beruhigungsmitteln (Tranquilizer).
Zur Entstehung von Ängsten
Warum manche Menschen im Laufe ihres Lebens eine Angststörung entwickeln, ist nicht immer erklärbar. Während man zu Beginn der Angstforschung Anfang letzten Jahrhunderts noch häufig annahm, dass Ängste durch negative Erfahrungen hervorgerufen werden, ließ sich das im weiteren Fortschritt der wissenschaftlichen Erforschung nicht halten. Angstpatienten haben nur in den allerseltensten Fällen zu Beginn ihrer Erkrankung ein negatives Erlebnis, das in einem Zusammenhang mit der Angstreaktion steht. Dieses Modell trifft am ehesten noch zu bei der Entstehung von spezifischen Phobien, z. B. wenn jemand mit einer Hundephobie von einem Hund gebissen wurde. Dieses Modell nennt sich klassische Konditionierung und geht zurück auf Experimente von Watson & Rayner (1920). 8
Eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Ängsten spielt das sogenannte Modelllernen. Ängstliche Eltern haben eine größere Wahrscheinlichkeit, auch ängstliche Kinder zu bekommen, da sich die Kinder die Sorgen und Befürchtungen der Eltern zu eigen machen.
Das Modelllernen spielt auch im Erwachsenenalter eine wichtige Rolle; so werden junge Polizisten, die mit erfahreneren, aber ängstlichen Kollegen in bestimmte Einsatzlagen gehen, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit diese Ängste übernehmen und im weiteren Berufsleben hier möglicherweise unsicherer oder – positiv formuliert – vorsichtiger sein, als wenn sie Kollegen gehabt hätten, die nicht ängstlich reagieren.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Grundwissen Psychisch Kranke»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Grundwissen Psychisch Kranke» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Grundwissen Psychisch Kranke» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.