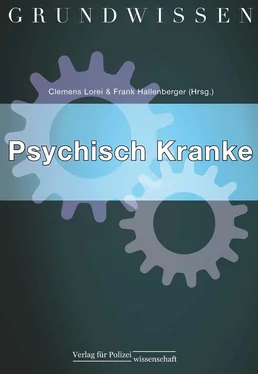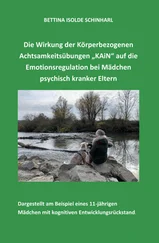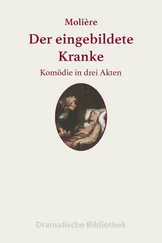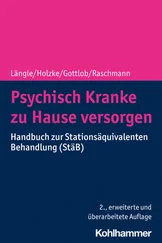Grundwissen Psychisch Kranke
Здесь есть возможность читать онлайн «Grundwissen Psychisch Kranke» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Grundwissen Psychisch Kranke
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Grundwissen Psychisch Kranke: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Grundwissen Psychisch Kranke»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Grundwissen Psychisch Kranke — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Grundwissen Psychisch Kranke», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Versuche, Persönlichkeiten zu kategorisieren, reichen bis in die Antike zurück. Hier gab es erstmals in der sogenannten „Säftelehre“ 6den Versuch, vier Persönlichkeitstypen zu unterscheiden, deren Verschiedenheit man auf eine jeweils andere Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit (griechisch: „cholé“) zurückführte. Dieses Modell hatte über viele Jahrhunderte hinweg bis in die Renaissance hinein Bestand und wirkt bis heute nach in Begriffen wie „Choleriker“ (= aufbrausender Mensch, Hitzkopf) oder „Melancholiker“ (griechisch „melas“ = schwarz, Krankheit der schwarzen Galle, schwermütiger Mensch).
1.1 Dimensionale Persönlichkeitsmodelle
Mit Beginn der Wissenschaftsära favorisierte man unter dem Einfluss einer akademischen Psychologie, die sich mit statistischen Methoden dem Problem näherte, sogenannte dimensionale Modelle zur Bestimmung der Persönlichkeit.
Dabei werden bestimmte Grundzüge der Persönlichkeit in ihrem Ausprägungsgrad zu erfassen und zu quantifizieren versucht. Ein Mensch kann demnach mehr oder weniger introvertiert, mehr oder weniger emotional erregbar, mehr oder weniger verträglich usw. sein. Bei der dimensionalen Modellierung geht man in der Regel davon aus, dass es kontinuierliche Übergänge von gesund nach krank und auch zwischen den einzelnen Persönlichkeitsstörungen gibt.
Als Beispiel sei das psychobiologische Persönlichkeitsmodell des amerikanischen Psychiaters und Genetikers C. Robert Cloninger 7genannt. Er unterschied vier angeborene bzw. vererbte Temperamentsdimensionen (nach Neuem suchen, der Bestrafung entgehen, Belohnung nötig haben, ausdauernd sein) von drei, eher auf Lernerfahrungen und biographische Prägungen zurückgehenden Charakter-Dimensionen (Selbstkontrolle, Kooperativität, Selbsttranszendenz).
Ein weiteres, sehr einflussreiches dimensionales Modell ist das „Big-Five-Modell“ 8, nach dem sich Menschen in den Merkmalen „Neurotizismus“ (emotionale Labilität), „Extraversion“ (Begeisterungsfähigkeit), „Offenheit für Erfahrungen“ (Interesse/Neugier/geistige Beweglichkeit), „Verträglichkeit“ (Konformität) und „Gewissenhaftigkeit“ (Rigidität) unterscheiden. Das Modell hat vor allem in der Persönlichkeitsforschung und psychosomatischen Forschung eine weite Verbreitung gefunden. Die einzelnen Merkmale sollen jeweils zu ca. 50 % auf vererbte Faktoren zurückgehen.
1.2 Kategoriale Persönlichkeitsmodelle
Die klinische Psychiatrie bevorzugt seit jeher sogenannte kategoriale Modelle der Persönlichkeitsstörungen, die in der Tradition der Psychiater Emil Kraepelin und Kurt Schneider 9hervorstechende Eigenschaften zur Definition von Persönlichkeiten heranziehen (Typologien). Dabei wurden früher – recht unsystematisch – einmal vorherrschende Gefühle (z. B. betriebsame Heiterkeit oder Traurigkeit), ein anderes Mal auffällige soziale Verhaltensmuster (z. B. Selbstunsicherheit), volitionale Merkmale (z. B. Fanatismus oder Willensschwäche) oder die gefühlsmäßige Ansprechbarkeit (z. B. Überschwänglichkeit oder Explosibilität) zur Bezeichnung der Wesensart genutzt.
Mitunter wurden auch körperliche Merkmale zur Unterscheidung herangezogen (Konstitutionstypen); die Nähe zu den alten humoralpathologischen Modellen war dabei oft spürbar. So sollten nach Kretschmer 10explosible Psychopathen häufiger einen athletischen Körperbau aufweisen, während pyknische, also untersetzte Menschen, eher gemütvoll bis depressiv seien. Diese konstitutionstypologischen Unterteilungen ließen sich durch moderne wissenschaftlich-statistische Verfahren selten nachvollziehen.
1.3. Persönlichkeitsdiagnostik in der klinisch-psychotherapeutischen Praxis
In der klinisch-psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxis werden bis heute Persönlichkeitskategorien genutzt, die nun aber in Merkmalskatalogen, sogenannten Diagnose-Manualen, möglichst nachvollziehbar beschrieben werden (s. Abschnitt 2).
In der Praxis ist die Entscheidung, wann eine Persönlichkeit gestört ist und wann Behandlungsbedürftigkeit vorliegt, dennoch sehr schwierig. Es gibt Grauzonen. Es gibt mehr oder weniger deutliche Ausprägungen (Akzentuierungen) von Persönlichkeitsmerkmalen, die mit mehr oder weniger starkem Leidensdruck einhergehen.
Was in starker Ausprägung Leid verursacht, ist in eher verdünnter Form kaum störend und manchmal sogar hilfreich. Was unter bestimmten Umständen Probleme verursacht, ist unter anderen Bedingungen funktional: In ruhigen
Tabelle 1
| Durchschnittsmenschen | Variationen der Persönlichkeit | Akzentuierte Persönlichkeiten | Abnorme Persönlichkeiten |
| Eher hypothetisches Konstrukt. Gibt es ihn doch, dann ist er keine „Persönlichkeit“ im philosophischen Sinne (nämlich respektabel, initiativ, sein Leben in die Hand nehmend usw.). | Es gibt z. B. spontane, nachdenkliche, ängstliche, genaue, zurückhaltend-vorsichtige Menschen, die alle als „normal“ zu bezeichnen sind. | Sehr ausgeprägte Eigenschaften: z. B. impulsiv (statt spontan), grüblerisch (statt nachdenklich), zwanghaft-übergenau (statt genau), misstrauisch (statt vorsichtig) usw. | Sie leiden unter ihren Eigenschaften und/ oder ihre Mitmenschen leiden darunter. Kollision mit ethischen/ rechtlichen Normen und Konventionen kommen häufiger vor. |
| Ohne Bedeutung in Medizin/Psychologie und wohl auch in der Gesellschaft. In der Literatur mit ironischem Unterton oft als „Normopathen“ *bezeichnet. | Heute auch als Persönlichkeitsstil **bezeichnet. Variationen bereiten in der Regel keine Probleme. Persönlichkeitsakzentuierungen können je nach Lebensumständen zu Leidensdruck führen, aber auch noch zu Hochleistungen disponieren (z. B. schätzt man an Polizisten die Eigenschaft der Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit; impulsive Beamte bekommen aber irgendwann Probleme). | Heute auch als Persönlichkeitsstörung bezeichnet. Entsprechende Persönlichkeiten bekommen auch ohne ungünstige äußere Umstände Probleme in verschiedenen Lebensbereichen. |
*Z. B. Lütz, M. (2009). Irre – Wir behandeln die Falschen: Unser Problem sind die Normalen – Eine heitere Seelenkunde. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus
**Kuhl, J. & Kazén, M. (1997). Persönlichkeits-Stil und Störungs-Inventar (PSSI). Göttingen: Hogrefe
Zeiten, wenn alles seinen gewohnten Gang geht, mag z. B. ein übergenauer (zwanghafter) Mensch sehr gut funktionieren, in den Turbulenzen einer beruflichen Veränderung (z. B. im Zuge einer Verwaltungsreform) verliert er möglicherweise leichter als andere den Boden unter den Füßen. Im Beamtenberuf bewährt er sich womöglich als Meister der exakten Ablage und buchstäblichen Gesetzestreue, als Erzieher im Kindergarten verzettelt er sich bei der Beherrschung des Chaos.
Diese Erkenntnis, dass sich weniger auffällige Persönlichkeiten in bestimmten Zusammenhängen und zu bestimmten Zeiten noch gut bewähren, stärker abweichende Persönlichkeiten bei der Lebensbewältigung jedoch immer wieder oder anhaltend scheitern, dabei leiden oder Leid verursachen, hat innerhalb der kategorialen Persönlichkeitsmodelle zu einer Dimensionierung geführt, die bis heute durchgehalten wird und z. B. in der psychoedukativen Arbeit mit Betroffenen genutzt wird. 11, 12
In Tabelle 1wird beispielhaft die Einteilung des Psychiaters Karl Leonhard dargestellt 13, der „Varianten der Persönlichkeit“, „Akzentuierte Persönlichkeiten“ und „Abnorme Persönlichkeiten“ unterscheidet. Heute (unterste Zeile der Tabelle) spricht man meistens von „Persönlichkeitsstilen“ und „Persönlichkeitsstörungen“. Dabei ist entscheidend, dass zwischen den einzelnen Kategorien fließende Übergänge bestehen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Grundwissen Psychisch Kranke»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Grundwissen Psychisch Kranke» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Grundwissen Psychisch Kranke» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.