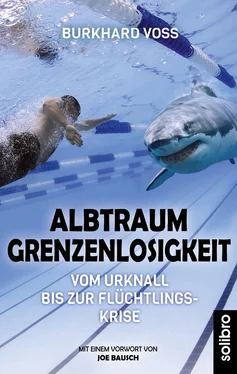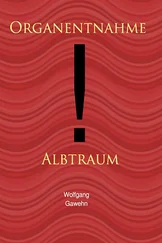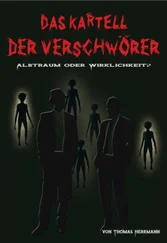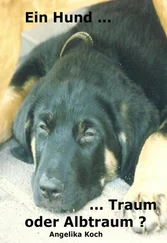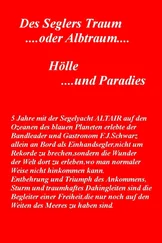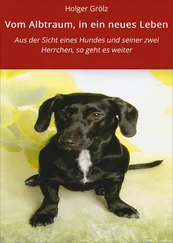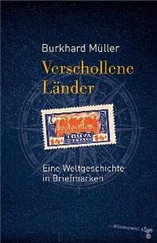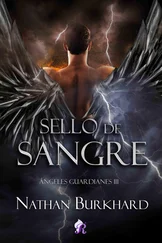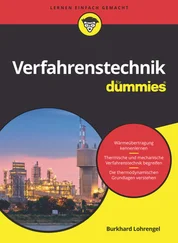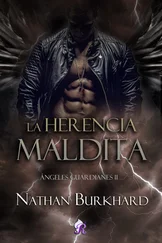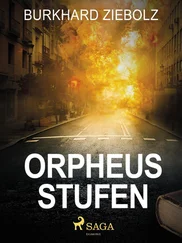Ursuppen sind unterschiedslos, erst die Grenzen ermöglichen Vielfalt. Und das von Anfang an.
Grenzen und Grenzenlosigkeit spielen auch eine wichtige Rolle in der aktuellen kosmologischen Forschung. Das Universum ist unendlich. Der Kosmos gilt als Synonym für Unendlichkeit. Oder ist das Universum vielleicht doch nicht unendlich? Hat es am Ende sogar Grenzen, wie letztlich alles, woraus der Kosmos besteht? Galaxien, Planetensysteme, einzelne Planeten, Sterne, die in der Frühphase der Entstehung als rote Riesen, in der Endphase als weiße Zwerge bezeichnet, Asteroiden, Sternschnuppen, Gesteinssplitter, einzelne Moleküle oder Atome – sie alle haben Grenzen, sind endlich. Wenn sie hinaus zum nächtlichen Sternenhimmel blicken, sind fast alle Menschen davon überzeugt, in die Unendlichkeit zu schauen. Wenn irgendetwas unendlich sein soll, dann das Universum. Dass es Unendlichkeit theoretisch gibt, beispielsweise in Form einer unendlichen Zahlenfolge, davon sind nicht nur Mathematiker überzeugt. Beim Universum war sich nicht nur Albert Einstein nicht so ganz sicher. Auch einige seiner heutigen Kollegen haben Zweifel. Viele Kosmologen sind von dessen Unendlichkeit überzeugt. Auf die Frage: „Woher wissen wir denn, dass das Universum unendlich ist?“ antwortete Prof. Dr. Achim Feldmeier vom Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam: „Das wissen wir gar nicht. Es gibt sogar die Vermutung, dass es – da es um 13. Mrd. Jahre alt ist – möglich auch nur 13. Mrd. Lichtjahre groß ist … wir können nur so weit sehen, wie sich das Licht seit dem Urknall zu uns hat ausbreiten können. Und das sind eben die 13. Mrd. Lichtjahre.“ Also auch hier wieder eine Grenze, der sogenannte Ereignishorizont (event horizon). Wir können aus physikalischen Gründen prinzipiell nicht dahinterschauen.
Ursuppen sind unterschiedslos, erst die Grenzen ermöglichen Vielfalt .
Damit der Mensch metaphysisch eine klare Orientierung und ein festes Bezugssystem habe, ging schon Aristoteles (384-322 v. Chr.) von einem endlichen Universum aus. Doch wenn der Kosmos eine Mauer oder einen Rand hat, was ist dahinter? Hier eine Endlichkeit zu postulieren, ist dem gesunden Menschenverstand nur schwer bis gar nicht nachvollziehbar. Das haben jedoch viele Erkenntnisse der modernen Physik – wie die Einstein’sche Relativitätstheorie und die Quantenphysik – gemeinsam. Trotzdem stimmen sie. Zum Beispiel Zeit und Lichtgeschwindigkeit: Dass die Zeit bei Erreichen der Lichtgeschwindigkeit (ca. 300.000 km/s) stehenbleiben soll, ist für uns Menschen nicht vorstellbar. Das liegt wahrscheinlich daran, dass solche Geschwindigkeiten jenseits unseres Erfahrungshorizonts liegen. Unabhängig vom gesunden Menschenverstand ist diese Aussage der Relativitätstheorie jedoch experimentell exakt nachgewiesen. Schwer vorstellbar auch, dass es eine Minustemperatur geben soll, die prinzipiell nicht weiter unterschritten werden kann. Dies ist jedoch ein Faktum, wird absoluter Nullpunkt genannt und liegt bei -273,15 0C. Vorstellbar wird es, wenn man Temperatur immer im Kontext von Reibung und insbesondere von Bewegung sieht, je höher die Bewegung von Teilchen, umso höher die Temperatur und umgekehrt. Noch stiller stehen als bei völligem Stillstand geht einfach nicht. Der völlige Stillstand liegt temperaturmäßig eben bei -273,15 0C. Ein nachvollziehbarer Gedanke. Deutlich mehr Gehirnakrobatik erfordert jedoch der Gedanke, dass das Universum eine Grenze hat, nach der sich per definitionem nur noch das Nichts befinden kann. Nach der Zahlen- und Formelakrobatik für viele Astrophysiker in sich logisch und plausibel. Andere Astrophysiker und der gesunde Menschenverstand kommen zu gegenteiligen Ergebnissen.
Fazit: So wenig Zweifel am Ursprung des Universums durch den Urknall bestehen, so wenig beantwortbar ist derzeit die Frage nach den Grenzen des Universums. Viele Elemente des Universums wie Planeten, Monde und Galaxien, bewegen sich in geordneten Bahnen. Grenzen und geordnete Bahnen haben mehr Verbindendes als Trennendes. Beide bilden etwas Konstantes, Feststehendes, eine gewissermaßen eherne Struktur in einem Raum, trennen innen von außen. Dass Planeten in gesetzmäßigen Abständen und Geschwindigkeiten um die Sonne kreisen, beschrieb als erster der deutsche Astronom Johannes Kepler (1571-1630). In akribischer Kleinarbeit wertete er die Messungen der Marspositionen aus und machte die bedeutsame Entdeckung, dass die vorher vermutete Kreisbahn falsch war. Der Mars beschrieb mit seiner Bahn um die Sonne eine Ellipse. Ebenso wie alle anderen Planeten auch. Das erste Keplersche Gesetz. Die elliptische Bahn beschreibt eine imaginäre Grenzkurve, die ein Innen zur Sonne hin von einem Außen zum Kosmos trennt.
Auf einem Planeten unseres Sonnensystems entstanden vor ca. 3,85 Mrd. Jahren nicht nur imaginäre Grenzen, sondern ganz konkrete.
2. Leben – nur durch ein Häutchen der Begrenzung möglich
Glaubte man in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts noch daran, das Leben sei vor 600.000 Jahren entstanden, geht man heute davon aus, dass die Entstehung vor 3,85 Mrd. Jahren begann. In der Erdgeschichte ein sehr früher Zeitpunkt, denn erst vor 3,9 Mrd. Jahren war der Erkaltungsprozess so weit fortgeschritten, dass sich auf der zähflüssigen und glühend heißen Planetenkugel so etwas wie eine feste Erdkruste bilden konnte. Trotzdem ein ziemlich ungemütlicher Ort, wo düstere Regenwolken mit sintflutartigen Regenfällen für allmähliche Abkühlung sorgten und die Ur-Ozeane entstanden. Die Rohbausteine des Lebens wie Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff sowie die daraus zusammengesetzten einfachen Verbindungen Wasser, Kohlendioxid, Methan und Ammoniak waren zweifellos vorhanden. Doch wie sollten sich daraus hochkomplexe Moleküle bilden mit Hunderten von Atomen und dreidimensionalen Strukturen? Wie entstanden Nukleinsäuren, die Träger des genetischen Codes? Wie Hämoglobin oder Chlorophyll, die eine bedeutsame Rolle im Energiestoffwechsel des tierischen bzw. pflanzlichen Organismus’ spielen? Alle diese Moleküle werden seit Jahrmillionen von Pflanzen und Tieren gebildet, die sich vor 3,85 Mrd. Jahren noch lange im evolutionären Dornröschenschlaf befanden. Biochemikern verursachte insbesondere in den 1950er-Jahren ein Problem unruhige Nächte: Wie konnten die Bausteine der Biologie in einer abiotischen Umwelt entstehen? Mit komplizierten Laborapparaturen war dies möglich, aber derartige Apparaturen existierten zum gegebenen Zeitpunkt nicht. Der US-amerikanische Biologie und Chemiker Stanley Miller (1930-2007) ging getreu dem Motto „in simplicitate veritas“, im Einfachen liegt Wahrheit, einen anderen Weg. Er imitierte den Zustand der frühen Erdkugel in einem Glaskolben, der zur Hälfte mit Wasser gefüllt war, darüber befand sich ein Gemisch aus den Gasen Wasserstoff, Methan, Sauerstoff, Stickstoff und Ammoniak. In diesem Gasgemisch wurden regelmäßig Funken erzeugt und das Ganze wurde bis zum Kochen erhitzt. Schon 24 Stunden später konnte er die wichtigsten Aminosäuren Glycin, Alanin und Asparagin nachweisen. Aminosäuren gelten als die „Bausteine des Lebens“. Der erste Schritt war getan. Im nächsten mussten sich die Aminosäuren zu Proteinen, also komplexen Eiweißmolekülen verknüpfen, aus denen die wesentlichen Funktionseinheiten der Pflanzen und Tiere bestehen. Dazu gehören die oben schon erwähnten Moleküle Chlorophyll und Hämoglobin, aber auch alle anderen Gewebsstrukturen und Organe können ihre Aufgaben nur durch Proteine erfüllen – und durch Nukleinsäuren (DNA und RNA), die den Aufbau der Proteine bestimmen. Doch was nützen alle die Bausteine des Lebens, so lange sie orientierungslos im Ur-Ozean umherschwirren? Nichts. Leben konnte erst durch Membranen entstehen, feinen, filmartigen, aus Eiweiß und Fettmolekülen bestehenden Strukturen, die das Innen vom Außen trennen und das Innere weiter unterteilen, die bestimmen, welche Stoffe und Moleküle nach innen wie nach außen gelangen.
Читать дальше