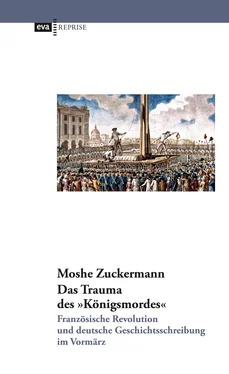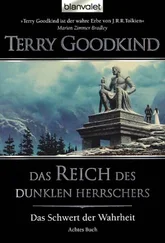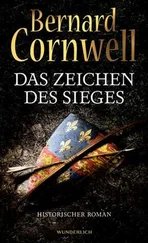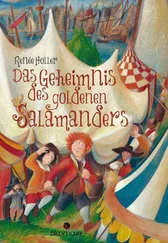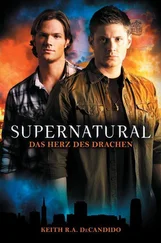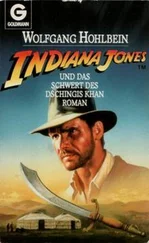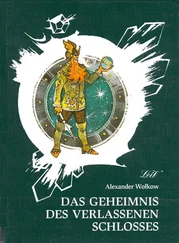Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes
Здесь есть возможность читать онлайн «Moshe Zuckermann - Das Trauma des Königsmordes» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Das Trauma des Königsmordes
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Das Trauma des Königsmordes: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Trauma des Königsmordes»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Trauma des Königsmordes — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Trauma des Königsmordes», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Diese enge Verbindung zwischen dem kollektiv-psychischen Pattern und der ideologischen Struktur ist der Schlüssel zum Verständnis der Tragweite der Französischen Revolution in ihrer Bedeutung als ein die politische Kultur des Bildungsbürgertums im Vormärz und in der Folgezeit prägender Faktor. Wir haben oben dargelegt, daß der Revolutionsrezeption eine emotionale Matrix unterlegt ist, welche sich kognitiv in einem ideologischen System artikuliert. 61Es erhebt sich nun die Frage, durch welche in der Französischen Revolution auftauchenden Motive die beide Beziehungsebenen, nicht nur während des aktuellen Geschehens, sondern auch noch vierzig oder fünfzig Jahre später aktiviert werden. Die Beantwortung dieser Frage hängt mit einer prinzipiellen Klärung des Begriffs »Rezeption« zusammen, wie wir ihn hier verwenden. Wir gehen von der Grundannahme aus, daß historische Ereignisse gemeinhin kodifiziert erfaßt werden: Der Gesamtkomplex historischer Tatsachen enthält Schlüsselworte, Namen und Begriffe, deren Gebrauch eine bestimmte Assoziationsstruktur erweckt. Die Assoziationen können sich mit den Tatsachen verbinden oder gar decken, sie können sich aber auch – und das ist im anstehenden Zusammenhang besonders wichtig – vom eigentlichen historischen Ereignis loslösen, um sich als quasi autonome Gedankengebilde zu verselbständigen. Wir nennen solche Schlüsselbegriffe »Kodes« und schreiben ihnen die Funktion der Symbolisierung von Gestalten, Dingen, Ideen oder Prozessen zu. Unserer Ansicht nach ist es die jedem historischen Ereignis innewohnende »Kode-Matrix«, welche die Rezeption eben dieses historischen Ereignisses erst eigentlich ermöglicht.
Die Französische Revolution assoziert sich, beispielsweise, wie von selbst mit Begriffen und Namen wie »Menschenrechte«, »Guillotine«, »Terror«, »Robespierre«, »Danton« u.s.w. Es ist klar, daß der Begriff »Menschenrechte« (zumindest bei uns heute) eine emanzipatorische Assoziation hervorruft, wohingegen »Guillotine« und »Terror« die von Gewalt und Unterdrückung. »Robespierre« kann sowohl die Gewalt als auch die Befreiung der »Massen« repräsentieren – es hängt ganz vom ideologischen Ansatz ab 62; im Grunde kann sich der Begriff »Revolution« selbst sowohl mit »besserer Welt« als auch mit »Zerstörung und Chaos« in Verbindung setzen lassen. Oft erscheint eine solche Zweideutigkeit nicht unbedingt als dichotomische Möglichkeit der Wahl, sondern als untrennbare Einheit (z.B. »Menschenrechte« und »Terror« oder »Mirabeau« und »Marat«). Dies hängt mit der Ambivalenz zusammen, welche sich gemeinhin mit der Idee der Revolution verbindet; sie wird begriffen als ein Etwas, das sowohl die Verheißung einer besseren Zukunft als auch den Preis der Zerstörung und des Chaos für die Verwirklichung eben dieser Verheißung zum Inhalt hat. So lassen sich denn die spezifischen Kodes der Französischen Revolution in vier Sinnwelten zusammenfassen, welche, aneinandergereiht, ihre Kode-Matrix darstellen: »Auflehnung gegen die Autorität«, »Gewalt«, »Emanzipation« und »Ambivalenz«. Obwohl sich die Erscheinungsform dieser Kodes von Fall zu Fall ändern kann und obgleich sie nicht immer leicht zu identifizieren sind, meinen wir feststellen zu dürfen, daß sie in dieser oder jener Form in jeder historiographischen (und wohl nicht nur historiographischen) Rezeption der Revolution vorzufinden seien.
Man kann dagegen einwenden, daß diese Feststellung wohl eine Selbstverständlichkeit sei: Begann doch die Revolution tatsächlich als eine Auflehnung gegen die traditionellen Autoritäten, es gab in ihr wirklich extreme Erscheinungen der Gewalttätigkeit, und sie bewirkte in der Tat die politische Emanzipation der sich auflehnenden Bevölkerung; und weil eben in ihr Freiheit und Tod, Emanzipation und Repression nebeneinander und gleichzeitig auftraten, kann das Gefühl der Ambivalenz als legitim und natürlich erachtet werden. Die Kode-Matrix hat also nichts anderes zum Inhalt als was die historischen Fakten ohnehin zeigen, und es ist von daher nur zu logisch, daß sie sich aus jeder einigermaßen akzeptablen Geschichtsschreibung der Französischen Revolution herauslesen läßt. Darauf muß in zweierlei Hinsicht geantwortet werden:
Erstens: Nicht der Konnex zwischen den Kodes und dem historischen Ereignis ist im zur Debatte stehenden Zusammenhang relevant, sondern die Tatsache, daß die Kodes zwischen dem, was in dem Ereignis selbst motivisch enthalten ist, und dem Assoziationshorizont, der sich (unabhängig von der Beziehung zum konkreten historischen Geschehen) auf der Grundlage dieser Motive auftut, vermitteln. D.h., wir sind nicht an der Strukturierung der Französischen Revolution zwecks besseren Verständnisses ihrer selbst interessiert, sondern an den in ihr befindlichen Gebilden, welche ihren Rezeptionsprozeß im historischen Zusammenhang dieses Prozesses selbst bestimmen. 63
Zweitens (und dieser Punkt ist entscheidend für unsere These): Die oben dargestellte Kode-Matrix ist nicht nur die der Französischen Revolution. Wie wir im 2. Kapitel noch ausführlich darlegen werden, sind die in ihr enthaltenen Kodes auch Schlüsselbegriffe der Freudschen Konzeption des ödipalen Konflikts. Kodifiziert läßt sich dieser Konflikt beschreiben als emotionales Bestreben des (männlichen) Kindes zur gewalttätigen Auflehnung gegen die Autorität des Vaters (um der Mutter willen); dieses Bestreben ist in der Realität zum Scheitern verurteilt, unter anderem wegen der ambivalenten Gefühle des Kindes seinem potentiellen Opfer gegenüber. Das aus diesem Konflikt resultierende Schuldgefühl ist ein Haupthindernis im langwährenden Kampf um die Emanzipation , welches das Kind bestreiten muß, um seine emotionale Abhängigkeit von den Eltern überwinden und sich auf dem Weg der Entwicklung zum eigenständigen Individuum von der Autorität seines Vaters lösen zu können.
Wie wir oben bemerkten, erachten wir nicht die sich aus der Parallelisierung beider Ebenen ergebende Ähnlichkeit als bedeutsam, sondern die Tatsache, daß die in der Matrix der Französischen Revolution enthaltenen Kodes emotionale Kodes anregen, welche aus einer persönlichen psychischen Erfahrung »bekannt« sind, einer Erfahrung, von der wir annehmen, daß sie universell sei. Das ist der Grund dafür, daß der Hinrichtung des Königs durch die französischen Revolutionäre eine archetypische Bedeutung beigemessen wird – dies umso mehr, als es sich (in unserem Fall) um die Rezeption des Ereignisses durch den autoritären Charakter handelt. Dies will wohl verstanden sein: Wir behaupten nicht, daß die Hinrichtung des Königs den ödipalen Konflikt als solchen erweckt, sondern, daß das, was Fromm »emotionale Matrix« nennt, als ein im ödipalen Konflikt verwurzeltes Pattern der Rezeption zugrunde liegt und sich im Fall des autoritären Charakters in eigentümlichen Rezeptionsstrukturen artikuliert. Der König symbolisiert den Vater, weil beide, König wie Vater, zur Kategorie »Autorität« 64gehören, und eben diese Kategorie ist, wie wir erläutert haben, von entscheidender Bedeutung für die Reaktion des autoritären Charakters auf Geschehnisse, welche die Autorität involvieren: Die äußere Reaktionsdimension findet sich in der politischen Ideologie vor, aber deren latente, im allgemeinen unbewußte Quelle ist im psychologischen (aus der Kode-Matrix herauslesbaren) Pattern verankert.
Kehren wir also zur Darlegung unserer Hauptthese zurück. Wir vertreten die Auffassung, daß eine Verbindung der Kode-Matrix der Französischen Revolution mit der emotionalen Matrix des autoritären Charakters der spezifischen Rezeption der historischen Umwälzung durch das deutsche Bürgertum zugrunde lagen, und daß sich diese Rezeption in einer politischen Ideologie niederschlug, deren praktische Bedeutung in der Unterlassung, ja Verweigerung einer tatsächlich vollzogenen Auflehnung gegen die (herrschende) Autorität zu sehen ist. Dies besagt nicht, daß es keine Erscheinungen der Auflehnung gab, sie wurden aber sublimierend in die Welt des Geistes verlagert 65: Der aggressive Bestandteil der Beziehung zur Autorität verwirklichte sich nicht als politisch-emanzipatorischer Akt, sondern verharrte im Rahmen einer ideellen Konzeption, die die Veränderung zwar ideologisch denkt, sie aber nicht in die Praxis umsetzt. 66Unserer Auffassung nach läßt sich diese Neigung als typisches Charakteristikum deutscher politischer Kultur im 19. sowie im 20. Jahrhundert, als der Autoritarismus im nationalsozialistischen Regime kulminierte, verfolgen. In diesem Sinne muß wohl auch Adornos (gegen den Begriff des »Volkscharakters« gerichtetes) Diktum verstanden werden: »Die Wendung nach innen, das Hölderlinsche Tatenarm doch gedankenvoll, wie es in den authentischen Gebilden um die Wende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts vorwaltet, hat die Kräfte gestaut und bis zur Explosion überhitzt, die dann zu spät sich realisieren wollten. Das Absolute schlug um ins absolute Entsetzen. Waren tatsächlich über lange Zeiträume der früheren bürgerlichen Geschichte hinweg die Maschen des zivilisatorischen Netzes – der Verbürgerlichung – in Deutschland nicht so eng gesponnen wie in den westlichen Ländern, so erhielt sich ein Vorrat unerfaßt naturhafter Kräfte. Er erzeugte ebenso den unbeirrbaren Radikalismus des Geistes wie die permanente Möglichkeit des Rückfalls.« 67
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Trauma des Königsmordes» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Das Trauma des Königsmordes» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.