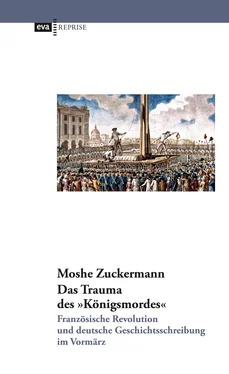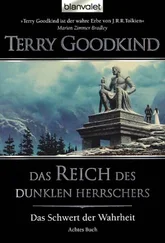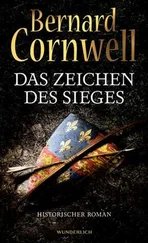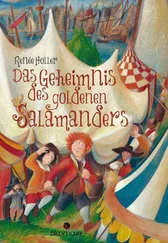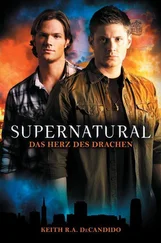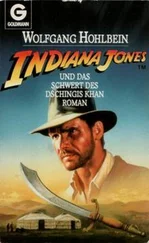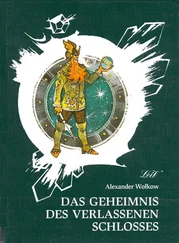1 ...7 8 9 11 12 13 ...35 Das historische Indiz für eine solche Interpretation läßt sich am deutlichsten an der Wende in der Reaktion der meisten deutschen Gebildeten auf die Revolution erkennen. Diese Wende setzt zwar vor der Hinrichtung an, jedoch auch da immer im Zusammenhang mit dem, was sich als Auflehnung gegen die Autorität auslegen läßt. In ihren Anfängen wird die Revolution mit großem Jubel empfangen, der in den beiden ersten Jahren teilweise verklingt, mit dem Schock, den die Hinrichtung des Königs auslöst, aber vollends in Abscheu und allgemeine Verwerfung umschlägt. Dieser Prozeß reflektiert an sich das Element der Ambivalenz in der Beziehung zum Gesamtereignis. Von Anfang an ist die Französische Revolution im Grunde nichts anderes als eine Auflehnung gegen die Autorität 52, und eben diese ersten Phasen werden von den deutschen Gebildeten begrüßt, weil sich in ihnen der Ausdruck einer eigenen Aggression gegen die Autorität ermöglicht; es handelt sich hierbei freilich um den von Fromm als »Rebellion« bezeichneten Reaktionsmodus: Die deutschen Gebildeten können eine Rebellion gegen die Autorität akzeptieren, nicht aber eine wirkliche Revolution , welche die Autorität gänzlich stürzen würde. Als die französischen Revolutionäre den entscheidenden Schritt machen, indem sie die Monarchie abschaffen und den König physisch liquidieren, setzt sich der autoritäre Charakter der deutschen »Beobachter« in eine psychisch motivierte ideologische Reaktion um, welche sie alsdann veranlaßt, dem gesamten Geschehen den Rücken zu kehren.
Wir werden die individuell-psychischen Quellen der Ambivalenz weiter unten noch zu erörtern haben. Es scheint indes angebracht, schon an dieser Stelle hervorzuheben, daß sich das in diesem konkreten historischen Zusammenhang beschriebene Pattern bei allen politischen Schlüsselereignissen im Verlauf der deutschen Geschichte – von der Französischen Revolution bis hin zum Revolutionsversuch von 1848, wo es am entscheidenden Moment moderner deutscher Geschichtsentwicklung am krassesten zum Ausdruck kommt und den erfolgreichen Abschluß der Revolution letztlich verhindert – reproduzierend wiederholt.
Damit soll nicht behauptet werden, der autoritäre Charakter sei ein Produkt der Französischen Revolution gewesen. Seine kollektive Genese hing vielmehr mit der historischen Sonderheit der strukturellen Entwicklung Deutschlands in den der Revolution vorangegangenen Jahrhunderten, mit den der territorialen Zersplitterung einwohnenden Erziehungsprozessen und mit der aus ihnen erwachsenen partikularistischen Mentalität und »politischen Kultur« zusammen. 53Und dennoch: Die Bedeutung der Französischen Revolution als katalysierender Faktor für die Verfestigung und historische Objektivierung des latenten Patterns in der Ára nach dem großen französischen Ereignis kann gar nicht übertrieben werden; denn die Revolution, als Scheideweg moderner Geschichte, erstellt einen neuen und bis dahin unbekannten Maßstab für die politische Ideologiepraxis. Sie bettet die Auflehnung gegen die konventionelle Autorität in eine umfassende Konzeption der Emanzipation ein: Sie affirmiert nicht nur die bewußtseinsmäßige Möglichkeit, daß der Sturz der Autorität weder eine Sünde noch die Übertretung eines sakralen Tabus darstelle, sondern erhebt ihn gar zur notwendigen Bedingung für die Befreiung des Menschen von seinen herkömmlichen sozialen und politischen Fesseln. Das der Revolution von der Seite »zuschauende« Kollektivsubjekt (wie etwa die deutsche Gebildetenschicht) kann diese Option nicht mehr ignorieren, wenn es daran geht, seine politischen und sozialen Zielsetzungen zu definieren. Freilich, gerade das Revolutionäre am Beschreiten des neuen Weges – d.h. gerade das Verlassen bekannter Strukturen zugunsten der bedrohenden Kontingenz einer ungewissen Zukunft (und trotz der in ihr utopisch umrissenen emanzipatorischen Verheißung) – kann all jene Ängste aufkommen lassen, welche die revolutionäre Wegbeschreitung verhindern und die Klammerung an die bestehenden Verhältnisse sichert, deren wichtigstes und bekanntestes Kontinuitätssymbol eben von der politischen Autorität verkörpert wird.
Wir betonen die Dimension der Entscheidung hinsichtlich der Rezeption der Revolution und der in ihr enthaltenen Optionen. Wir meinen hierbei nicht eine bewußte, auf Zweckrationalität ausgerichtete Entscheidung 54, sondern die psychologisch motivierte, auf die Befriedigung emotionaler und mentaler Bedürfnisse zielende Entscheidung, der sich das Subjekt, trotz ihres offensichtlichen Widerspruchs zu seinen sozialen, ökonomischen und politischen Interessen, verschreibt. 55Dies bedeutet, daß die deterministische Dimension des autoritären Charakters als ihrem Wesen nach relativ zu begreifen ist und nicht als eine a priori gegebene alternativlose Unumgänglichkeit. Die Alternative manifestiert sich im Bewußtsein des Subjekts, im Bewußtsein seiner objektiven Lebensbedingungen und der zu deren emanzipierenden Veränderung aufzubringenden Opfer. 56Wenn das Subjekt es vorzieht, in seinen herkömmlich vorgegebenen Lebensbedingungen zu verharren, um sich deren Veränderung zu entziehen, trifft es eine Entscheidung, wenn es sich ihrer auch nicht immer bewußt ist. Die »Rechtfertigung« (d.h. die »logische« Erklärung für das Verharren in Bedingungen, die den eigenen Interessen widersprechen) nennen wir beim Individuum »Rationalisierung« und beim Kollektiv »Ideologie«. 57In diesem Sinne können wir also behaupten, daß jene typische Ideologiestruktur, welche sich in der Beziehung der Gebildetenschicht des Vormärz zur Revolution als politischem Mittel überhaupt und zur Französischen Revolution als historischer Vorgabe ausmachen läßt, ihre Quelle in einem für sie aufgrund einer historischen Entscheidung charakteristisch gewordenen autoritären Pattern hat. 58
Die inhärente Verbindung zwischen dem autoritären Pattern und der politischen Ideologie des Bürgertums ist in der hier zur Debatte stehenden historischen Epoche besonders eng, und zwar gerade wegen der eigentümlichen Rezeption der Französischen Revolution. Hatte doch diese Revolution die mit der Zügellosigkeit der unteren Schichten einhergehende »Gefahr« und »Bedrohung« deutlich bewiesen, indem sie deren von der »Freiheit« sozusagen sanktionierten »triebhafte Wildheit« konkret veranschaulichte. Es kann freilich von einer etablierten, auf die Kaschierung von Klasseninteressen ausgerichtete Ideologie, wie etwa die des Kapitalismus, noch nicht die Rede sein, denn der Industrialisierungsprozeß und die aus ihm resultierenden polaren Klassengegensätze waren im Vormärz-Deutschland noch nicht weit genug fortgeschritten und entwickelt. Es lassen sich gleichwohl erste Blüten dieses Prozesses nachweisen, und in jedem Fall bestand schon seit längerem die Neigung des Bürgertums, sich selbst »nach unten« hin zu bestimmen und abzugrenzen, und sei es mittels der Konzeption der »Bildung«, welche (genau genommen) zu einer Art politischen Parole dieser Klasse geworden war 59; in dieser Situation symbolisieren die unteren Schichten die »Unordnung«, die »Anarchie« und das »Chaos«. Diese Bedrohung ist deutlich genug, denn, wie gesagt, hatte die Französische Revolution die »Massen« als aktives Kollektivsubjekt mit konkret artikuliertem Willen und zielgerichteten Aspirationen auf die Bühne der Geschichte gehievt. Zwar läßt sich daher die ständig lauernde Gefahr der Gewalttätigkeit nicht aus der Welt schaffen, aber man kann ihr zumindest eine Schranke in der Gestalt der herkömmlichen politischen Autorität setzen, um wenigstens ihren akuten Ausbruch zu verhindern; gegen einen König erhebt man sich nun mal nicht so ohne weiteres, er garantiert daher die Erhaltung der althergebrachten sozialen Ordnung. 60Nach unserem Dafürhalten wurzelt das Streben des deutschen Liberalismus nach der konstitutionellen Monarchie und seine Bekämpfung der Republik in diesem für Deutschland eigentümlichen Zusammentreffen einer Verehrung »nach oben« und einer Angst »vor unten«, d.h. in der affirmierenden Verknüpfung des autoritären Charakters mit der politischen Ideologie.
Читать дальше