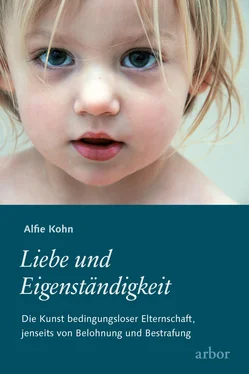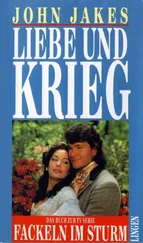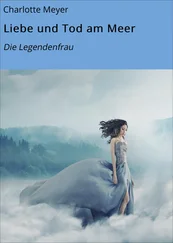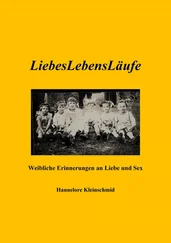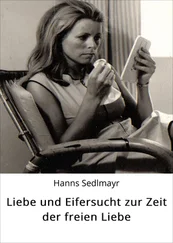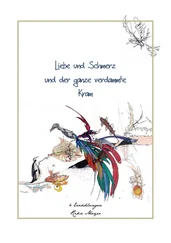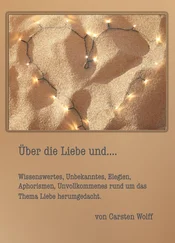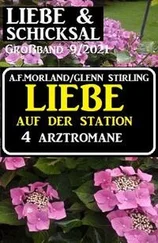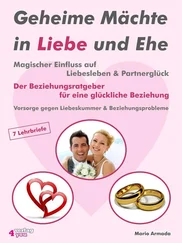Doch es gibt noch mehr Annahmen, die wir offenlegen sollten. In unserer Gesellschaft wird uns beigebracht, etwas Gutes müsse man sich stets verdienen und dürfe es niemals geschenkt bekommen. Viele Menschen werden sogar wütend, wenn sie glauben, diese Regel sei verletzt worden. Denken Sie zum Beispiel an die Ablehnung, die viele Menschen gegenüber Sozialhilfe und denjenigen, die sie beziehen, empfinden. Oder an die rasante Ausbreitung von leistungsorientierten Entlohnungssystemen am Arbeitsplatz. Oder an die vielen Lehrer, die alles, was Spaß macht, (etwa die Pause) als eine Art Lohn dafür definieren, dass die Schüler den Erwartungen des Lehrers entsprechen.
Letztlich spiegelt ein an Bedingungen geknüpftes Erziehungskonzept die Tendenz wider, fast jede Interaktion, sogar zwischen Mitgliedern einer Familie, als eine Art wirtschaftliche Trans aktion anzusehen. Die Gesetze des Marktes – Angebot und Nachfrage, wie du mir, so ich dir – haben den Status universeller und absoluter Grundsätze angenommen, als entspräche alles in unserem Leben, einschließlich unseres Verhaltens gegenüber unseren Kindern, dem Kauf eines Autos oder dem Mieten einer Wohnung.
Ein Autor eines Erziehungsratgebers – ein Behaviorist, was natürlich kein Zufall ist – drückt es so aus: „Wenn ich mit meinem Kind einen Ausflug machen oder wenn ich es umarmen und küssen möchte, muss ich mir erst sicher sein, dass es das auch verdient hat.“ 2Bevor Sie dies als die Ansicht eines einzelnen Extremisten abtun, denken Sie daran, dass die berühmte Psychologin Diana Baumrind (siehe S.124) ein ähnliches Argument gegen ein bedingungsloses Erziehungskonzept vorbringt: „Das Gesetz der Wechselseitigkeit, des Bezahlens für einen erhaltenen Wert, ist ein Lebensgesetz, das für uns alle gilt.“ 3
Auch scheinen viele Autoren und Therapeuten, die das Thema nicht explizit ansprechen, dennoch von einer Art ökonomischem Modell auszugehen. Wenn man zwischen den Zeilen liest, scheinen ihre Ratschläge auf der Ansicht zu beruhen, man solle Kindern das, was sie mögen, vorenthalten, wenn sie sich nicht so verhalten, wie wir es wollen. Schließlich sollte man nichts ohne Gegenleistung bekommen. Nicht einmal Glück. Oder Liebe.
Wie oft haben Sie Leute schon sagen gehört – nachdrücklich und trotzig –, etwas sei „ein Privileg und kein Recht“? Manchmal male ich mir aus, eine wissenschaftliche Studie durchzuführen, um zu ermitteln, welche Persönlichkeitsmerkmale im Allgemeinen bei Menschen zu finden sind, die diese Haltung vertreten. Stellen Sie sich jemanden vor, der darauf besteht, dass man alles, von Eis bis hin zu Aufmerksamkeit, davon abhängig machen sollte, wie Kinder sich benehmen, und es nie einfach verschenken sollte. Können Sie sich diese Person vorstellen? Welchen Gesichtsausdruck sehen Sie? Wie glücklich ist dieser Mensch? Genießt er oder sie es wirklich, mit Kindern zusammen zu sein? Hätten Sie diese Person gern zum Freund?
Wenn ich den Spruch „ein Privileg und kein Recht“ höre, frage ich mich oft, was derjenige, der das sagt, überhaupt als Recht ansehen würde. Gibt es irgendetwas, auf das Menschen einfach einen Anspruch haben? Gibt es keine Beziehungen, auf die wir lieber keine Wirtschaftsgesetze anwenden wollen? Zwar erwarten Erwachsene, für ihre Arbeit entlohnt zu werden, ebenso wie sie erwarten, für Essen und Trinken bezahlen zu müssen. Doch die Frage ist, ob oder unter welchen Umständen eine ähnliche „Gegenseitigkeitsregel“ auch für unseren Umgang mit Freunden und Familienmitgliedern gilt. Sozialpsychologen haben festgestellt, dass es tatsächlich Personen gibt, zu denen wir eine Art Austauschbeziehung haben: Ich tue nur etwas für dich, wenn du etwas für mich tust (oder mir etwas gibst). Doch sie fügen hinzu, dass dies (glücklicherweise) nicht für all unsere Beziehungen gilt, von denen manche auf Zuneigung statt auf Austausch beruhen. Eine Studie kam sogar zu dem Ergebnis, dass Menschen, die ihre Beziehungen zu ihrem Ehepartner als ein Tauschgeschäft sehen und darauf achten, genau so viel zu bekommen, wie sie geben, oft Ehen führen, die weniger befriedigend sind. 4
Wenn unsere Kinder heranwachsen, werden sie reichlich Gelegenheit haben, wirtschaftlich zu agieren, ihre Rolle als Verbraucher und Arbeitskraft einzunehmen, wobei die Regeln des Eigeninteresses und die Bedingungen jedes wirtschaftlichen Austausches präzise kalkuliert werden können. Doch das bedingungslose Erziehungskonzept plädiert dafür, dass die Familie ein sicherer Hafen, ein Ort der Zuflucht vor solchen Geschäften sein sollte. Insbesondere sollte man in keiner Hinsicht für die Liebe seiner Eltern bezahlen müssen. Sie ist schlicht und einfach ein Geschenk. Es ist etwas, worauf alle Kinder ein Anrecht haben.
Wenn Ihnen das einleuchtet und auch andere der zugrunde liegenden Annahmen des bedingungslosen Erziehungskonzepts für Sie plausibel klingen – dass wir das ganze Kind und nicht nur einzelne Verhaltensweisen betrachten sollten, dass wir nicht stets das Schlechteste über die Neigungen von Kindern annehmen sollen und so weiter –, müssen wir all die konventionellen Erziehungsmethoden, die auf dem Gegenteil dieser Annahmen beruhen, in Frage stellen. Diese Praktiken, die das an Bedingungen geknüpfte Erziehungskonzept bestimmen, sind meistens Arten, mit Kindern (als Objekten) etwas zu tun, um Gehorsam herbeizuführen. Im Gegensatz dazu sind die Empfehlungen in der zweiten Hälfte dieses Buches, die sich ganz natürlich aus dem bedingungslosen Erziehungsansatz ergeben, Variationen des Themas, mit Kindern zusammenzuarbeiten, um ihnen zu helfen, gute Menschen zu werden und gute Entscheidungen zu treffen.
Die Unterschiede zwischen diesen beiden Konzepten könnte man also folgendermaßen zusammenfassen:
|
BEDINGUNGSLOS |
AN BEDINGUNGEN GEKNÜPFT |
| Blick richtet sich auf |
Das ganze Kind (einschließlich der Gründe, Gedanken und Gefühle) |
Verhalten |
| Sicht der menschlichen Natur |
Positiv oder ausgeglichen |
Negativ |
| Sicht der Elternliebe |
Ein Geschenk |
Ein Privileg, das verdient werden muss |
| Strategien |
Zusammenarbeiten (Problemlösungen finden) |
Mit Kindern als Objekten etwas tun (Kontrolle durch Belohnungen und Bestrafungen) |
Die Folgen eines an Bedingungen geknüpften Erziehungskonzepts
Ebenso, wie es sein kann, dass unsere Erziehungsmethoden nicht im Einklang mit unseren langfristigen Zielen für unsere Kinder stehen (siehe Einleitung), kann es einen Widerspruch zwischen Methoden des an Bedingungen geknüpften Erziehungsansatzes und unseren tiefsten Überzeugungen geben. In beiden Fällen kann es sinnvoll sein, zu überdenken, was wir mit unseren Kindern tun. Doch die Argumente gegen ein an Bedingungen geknüpftes Erziehungskonzept hören nicht damit auf, dass es im Zusammenhang mit Werten und Annahmen steht, die viele von uns beunruhigend finden. Sie werden sogar noch stärker, wenn wir untersuchen, wie sich ein solcher Erziehungsstil tatsächlich auf Kinder auswirkt.
Vor fast einem halben Jahrhundert antwortete der bahnbrechende Psychologe Carl Rogers auf die Frage: „Was geschieht, wenn die Liebe der Eltern davon abhängt, was Kinder tun?“ Er erklärte, dass die Empfänger einer solchen Liebe die Teile von sich, die nicht geschätzt werden, ablehnen. Schließlich sehen sie sich selbst nur dann als wertvoll an, wenn sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten (oder entsprechend denken oder fühlen). 5Das ist im Grunde ein Rezept für eine Neurose – oder schlimmer. In einer Publikation des irischen Department of Health and Children (die von anderen Organisationen auf der ganzen Welt verbreitet und übernommen wurde) sind zehn Beispiele für „emotionale Misshandlung“ aufgeführt. Die Nummer zwei auf dieser Liste, gleich hinter „ständiger Kritik, Sarkasmus, Feindseligkeit oder Beschuldigung“, lautet „an Bedingungen geknüpfte Erziehung, bei der das Maß an Zuneigung, das einem Kind gegenüber ausgedrückt wird, von seinem Verhalten oder seinen Handlungen abhängig gemacht wird“. 6
Читать дальше